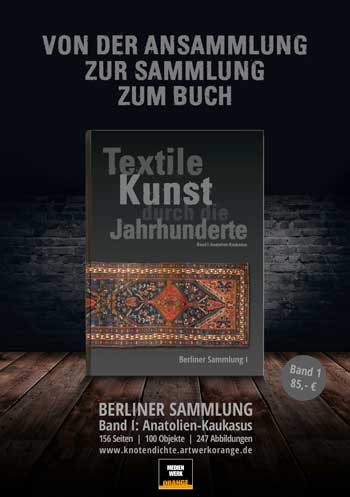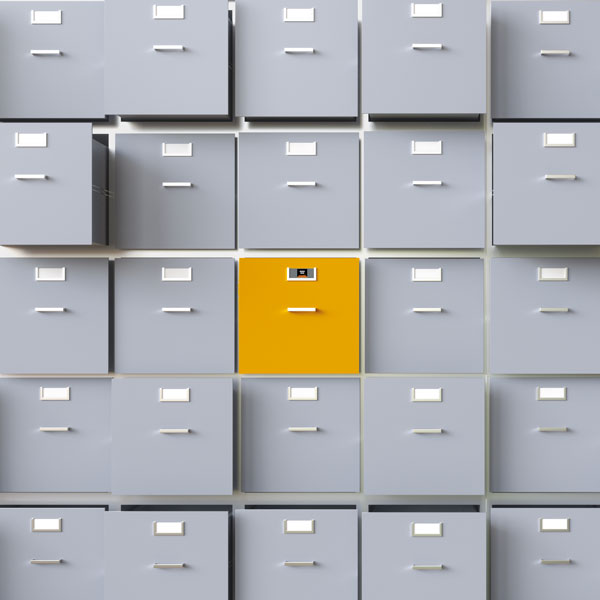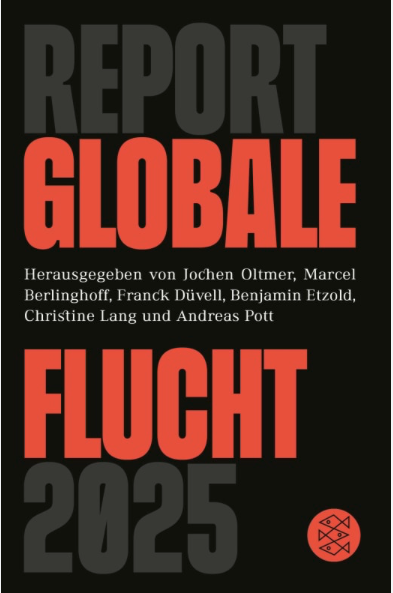Technik
Drei von vier Personen hören Radio digital
49 Millionen Menschen hören digitales Radio, das entspricht drei Viertel der Hörerinnen und Hörer. Vor allem Webradio und DAB+ sind hoch im Kurs. Gleichzeitig mischt auch Künstliche Intelligenz die Radiobranche auf. Das besagt die Sonderauswertung der „Audio Trends 2024“ von „Die Medienanstalten“. Mehr über den Grenzgang zwischen Effizienz und Publikumstäuschung.
„Die Zukunft des Radio ist digital“, das sagt die Sonderauswertung der ma 2024 Audio II. Drei Viertel der Radiohörenden in Deutschland nutzen digitale Angebote. Dazu zählen neben dem Webradio auch DAB+, Digital Audio Broadcasting, der digitale Nachfolger von UKW. DAB+ werde vor allem von den mittleren Altersgruppen stark genutzt.
Gleichzeitig verändere auch Künstliche Intelligenz die Radiolandschaft: Von automatisierten Moderationen bis zu ersten vollautomatisierten und KI-gesteuerten Radiosendern. Hierbei sei es auch wichtig, auf die Verantwortung beim Einsatz von Künstlicher Intelligenz zu achten. Es sei ein Grenzgang“zwischen Effizienzsteigerung und Publikumstäuschung“.
Ruth Meyer, Direktorin der Landesmedienanstalt Saarland und verantwortlich für die „Audio Trends“, betont: „Die Medienanstalten setzen klare Leitplanken für den KI-Einsatz im Hörfunk: Die Vielfalt darf nicht leiden, der Einfluss von KI muss transparent bleiben, und die Letztverantwortung liegt immer bei Menschen. „Gerade im sensiblen journalistisch-redaktionellen Bereich müssen Vorkehrungen getroffen werden, um Manipulationen der öffentlichen Meinungsbildung zu verhindern.“
Politik
Projekt-Arbeitsgruppe zum autonomen Fahren in Modellregionen
Berlin 23.02.2026
– Automatisiertes und vernetztes Fahren ist laut Bundesregierung eine Schlüsseltechnologie, um den Innovations- und Industriestandort Deutschland für den globalen Wettbewerb zu sichern. Die Bundesregierung arbeite daher kontinuierlich daran, die Rahmenbedingungen hierfür zu schaffen und zu verbessern. Dabei lieferten Forschungsprojekte „wichtige Erkenntnisse für den späteren Regelbetrieb“, heißt es in der Antwort (21/4114) auf eine Kleine Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen (21/3931).
Ziel der Bundesregierung sei es, den Übergang vom Pilotbetrieb in den Regelbetrieb zu beschleunigen, den Markthochlauf zu unterstützen und den Innovationsstandort Deutschland zu stärken. Dies entspräche auch der Strategie der Bundesregierung mit dem Titel „Die Zukunft fährt autonom“.
Die Entwicklung der im Koalitionsvertrag der 21. Legislaturperiode genannten Modellregionen gemeinsam mit den Ländern ist der Antwort zufolge ein konkreter Ansatz für die nationale Umsetzung, in Städten ebenso wie in ländlichen Räumen. „Daher begrüßt die Bundesregierung, dass die Verkehrsministerkonferenz in ihrer Sitzung vom 8. und 9. Oktober 2025 beschlossen hat, eine länderoffene temporäre Projekt-Arbeitsgruppe zum autonomen Fahren in Modellregionen einzurichten“, heißt es in der Antwort. Hinsichtlich der in der Anfrage angesprochenen Einzelheiten, wie etwa der räumlichen Ausgestaltung der Modellregionen, der Zahl der einzusetzenden Fahrzeuge und dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Modellregionen, seien die Ergebnisse der länderoffenen Projekt-Arbeitsgruppe abzuwarten, schreibt die Bundesregierung.
Soweit grenzüberschreitende Modellregionen in Zusammenarbeit mit Nachbarstaaten angesprochen werden, wird in der Antwort auf den am 5. März 2025 von der EU-Kommission veröffentlichten Aktionsplan für die EU-Automobilindustrie hingewiesen. Darin sehe die Kommission zur Förderung der Marktreife und Vermarktung autonomer Fahrzeuge die Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten vor, um grenzüberschreitende Umgebungen für autonomes Fahren einzurichten. „Die Bundesregierung erörtert das Thema derzeit mit der Kommission, Mitgliedstaaten und den Ländern. Die Ergebnisse dieser Diskussionen bleiben abzuwarten“, heißt es in der Vorlage.
Politik
Digital-Kompass startet mit neuem Schwerpunkt
Berlin, Bonn 19. 02.2026
– Digital-Kompass erleichtert Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten den sicheren und selbstbestimmten Umgang mit digitalen Verbraucherangeboten.
Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten stehen im digitalen Verbraucheralltag vor besonderen Hürden: Komplexe Sprache, unübersichtliche Nutzeroberflächen und fehlende barrierearme Informationen erschweren ihnen den Zugang zu digitalen Angeboten und erhöhen im Verbraucheralltag das Risiko wirtschaftlich und rechtlich nachteiliger Entscheidungen. Mit einem neu ausgerichteten Projekt im Rahmen des Digital-Kompass setzen die BAGSO – Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen e.V. und Deutschland sicher im Netz e.V. (DsiN) genau hier an. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) fördert das Projekt mit dem Titel „Digital einfach erklärt: Teilhabe für Verbraucherinnen und Verbraucher mit Lern- und Leseschwierigkeiten aktiv und verständlich gestalten“ im Zeitraum von Dezember 2025 bis einschließlich April 2028.
Im Mittelpunkt des Projekts steht die verständliche, niedrigschwellige Vermittlung digitaler Verbraucherkompetenzen für Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten und solchen mit Schwierigkeiten beim Erfassen längerer und komplexer Texte. Ziel ist es, dieser bislang wenig beachteten Zielgruppe den Zugang zu digitalen Angeboten zu erleichtern. Sie werden darin unterstützt Risiken besser einzuschätzen und informierte, selbstbestimmte Entscheidungen im digitalen Verbraucheralltag zu treffen.
„Mit dem neuen Projekt setzen wir bewusst einen inhaltlichen Schwerpunkt auf Menschen, für die digitale Informationen oft zu komplex oder nicht barrierefrei aufbereitet sind. Der Digital-Kompass steht dabei für verständliche, verbrauchernahe Angebote, die sich an den realen Bedarfen von Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten orientieren“, erklärt Isabelle Rosière, Geschäftsführerin von DsiN.
Bundesweites Netzwerk als Basis
Die Umsetzung erfolgt über das bundesweite Netzwerk von rund 300 Digital-Kompass-Standorten, die als wohnortnahe Anlaufstellen rund um digitale Fragen in der Bevölkerung bekannt sind. Im Rahmen des Projekts ist zudem der Aufbau weiterer Standorte geplant, um noch mehr Verbraucherinnen und Verbraucher zu erreichen.
„Verständliche Sprache und verbrauchergerechte Information sind zentrale Voraussetzungen für digitale Teilhabe, die alle einschließt. Ältere Menschen, die in ihrem Leben wenig Bezugspunkte zu digitaler Technik hatten, profitieren ebenso wie Personen mit Hör- oder Sehbeeinträchtigungen von den Angeboten des Digital-Kompass. Der Zugang zu digitalen Informationen und die entsprechenden Kompetenzen fördern soziale und gesellschaftliche Teilhabe.“, sagt Dr. Barbara Keck, Geschäftsführerin der BAGSO Service Gesellschaft.
Qualifizierung, Materialien und Vernetzung
Die Angebote des Digital Kompass richten sich sowohl unmittelbar an Verbraucherinnen und Verbraucher als auch an ehren- und hauptamtliche Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, die ihr Wissen weitertragen sollen. Sie umfassen:
- Online-Veranstaltungen zu zentralen Fragen des digitalen Verbraucherschutzes,
- Qualifizierungsangebote zur verständlichen und verbrauchergerechten Sprache,
- Fach- und Netzwerktagungen zum fachlichen Austausch, zur Weiterbildung und zur Vernetzung.
Ergänzt wird das Angebot durch Lern- und Lehrmaterialien, verständlich aufbereitete Publikationen, einen regelmäßig erscheinenden Podcast sowie Angebote auf der Website, auf Facebook und Instagram.
Die Bedeutung des Projekts unterstreicht auch Bundesverbraucherschutzministerin Dr. Stefanie Hubig: „Es ist wichtig, dass Informationen für alle leicht verständlich und zugänglich sind. Digitale Angebote machen den Alltag leichter und die Nutzerinnen und Nutzer in der Regel selbständiger. Für Menschen mit Lern- und Leseschwierigkeiten müssen Inhalte barrierefrei und einfach im Design gestaltet sein. Das gilt für den Kauf eines Zugtickets, den Wechsel des Stromvertrags oder auch für digitale Bankgeschäfte. Echte Teilhabe bedeutet, dass niemand ausgeschlossen wird – deshalb fördern wir das Projekt ‚Digital einfach erklärt‘.“
Das Projekt wird in Zusammenarbeit mit der Verbraucher Initiative e.V. (VI), dem Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. (DBSV), dem Deutschen Schwerhörigenbund e.V. (DSB) sowie Fachexpertinnen und -experten für verständliche und verbrauchergerechte Sprache umgesetzt.
Politik
Gesetzentwurf zur Digitalisierung der Migrationsverwaltung
Berlin 12.02.2026
– Die Bundesregierung hat einen Gesetzentwurf „zur Weiterentwicklung der Digitalisierung in der Migrationsverwaltung“ (21/4080) vorgelegt, der einem verbesserten und beschleunigten Datenaustausch zwischen öffentlichen Stellen im Migrationsbereich dienen soll. Ziel ist es, die Behörden zu entlasten und die Verwaltungsprozesse zu beschleunigen.
Zentraler Bestandteil der Regelungen des „Migrationsverwaltungsdigitalisierungsweiterentwicklungsgesetzes“ (MDWG) ist laut Bundesregierung die Schaffung einer Möglichkeit zur Speicherung und Weiterverwendung biometrischer Daten (Lichtbild, Fingerabdrücke und Unterschrift), die im Rahmen der Beantragung eines elektronischen Aufenthaltstitels im Inland erhoben worden sind. Daneben sind Regelungen enthalten, um allen im Visumverfahren beteiligten Behörden den Zugriff auf die „für Visaerteilung maßgebenden antragsbegründenden Dokumente“ zu erleichtern, wie die Bundesregierung in der Begründung weiter ausführt.
Um einen funktionierenden Informationskreislauf zwischen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sowie Ausländerbehörden auf der einen Seite und Trägern für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz auf der anderen Seite zu gewährleisten, sind den Angaben zufolge zudem Regelungen vorgesehen, durch die Umstand und Dauer einer Leistungseinschränkung oder eines Leistungsausschlusses im Ausländerzentralregister (AZR) abgebildet werden.
Ferner soll laut Vorlage geregelt werden, dass die Informationsübermittlung der Staatsanwaltschaften und Gerichte an die zuständigen Ausländerbehörden durch die Erfassung der relevanten Mitteilungen in Strafsachen zentral im AZR wesentlich verbessert wird. Schließlich werde „neben der strukturierten Erfassung von Angaben zur Identität ausländischer Personen die Möglichkeit geschaffen, amtliche Identifikationsdokumente und sonstige nichtamtliche Dokumente, die zur eindeutigen Identifikation der Person geeignet sind, als Volltextdokumente im AZR zu erfassen“.
Politik
Durchführungsgesetz zur KI-Verordnung beschlossen
Berlin 11.02.2026
Das Bundeskabinett hat heute das Durchführungsgesetz zur KI-Verordnung der Europäischen Union beschlossen. Das Gesetz benennt die nationalen Behörden zur Umsetzung der Verpflichtungen aus der KI-Verordnung. Auf frühzeitiges Betreiben von Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer, enthält der Gesetzestext zudem grundlegende Klarstellungen zur staatsfernen Medienaufsicht in Deutschland sowie der diesbezüglichen Zuständigkeit der Länder im Presse- und Rundfunkbereich. Dies betrifft insbesondere die Frage nach den Aufsichtsstrukturen zur Einhaltung der Transparenzpflichten, zum Beispiel bei der Kennzeichnung von Deepfakes und KI-generierten Nachrichtentexten.
Staatsminister für Kultur und Medien, Wolfram Weimer: „KI-Regulierung berührt immer auch Fragen der Medienregulierung, gerade hier in Deutschland. Bei der Umsetzung der KI-Verordnung der EU ist es deshalb wichtig, die Besonderheiten unserer föderalen und vor allem staatsfernen Medienordnung im Durchführungsgesetz zu berücksichtigen. Dafür habe ich mich intensiv – auch im Sinne der Länder – eingesetzt und begrüße sehr, dass dies gelungen ist.“
Der Staatsminister weiter: „Insgesamt ist das Durchführungsgesetz nur einer von vielen Bausteinen hin zu einem abgestimmten, europäischen Ordnungsrahmen für KI. Grundsätzlich gilt: Wer KI einsetzt, muss Verantwortung übernehmen. Genau dafür brauchen wir ein gemeinsames Verständnis und müssen diese Plattformverantwortlichkeit auch konsequent einfordern. Aktuelle Vorfälle rund um KI-Tools wie Grok zeigen deutlich, dass wir hierfür klare Regeln und regelmäßige Risikobewertungen brauchen.“
Der Schutz der digitalen Identität ist ein zentrales Anliegen der Medienpolitik der Bundesregierung. Ziel ist ein fairer und transparenter digitaler Informationsraum im KI-Zeitalter, der technologische Entwicklung ermöglicht und zugleich Meinungsvielfalt, kulturelle Leistung und demokratische Öffentlichkeit schützt. Staatsminister Weimer unterstützt daher ausdrücklich die Bestrebungen auf EU-Ebene, den Schutz vor Medienmanipulation, insbesondere digitaler sexualisierter Gewalt zu verbessern und die rechtlichen Möglichkeiten gegen Deepfakes zu verschärfen.
Politik
Safer Internet Day: Für mehr Fairness und Sicherheit Online

Berlin 10.02.2026
Bundesministerin der Justiz und für Verbraucherschutz Dr. Stefanie Hubig:
„Sicherheit und Fairness im Netz – das bedeutet auch wirksamen Schutz vor Geschäftspraktiken, die in die Irre führen, manipulieren oder süchtig machen. Wir brauchen hier bessere europäische Regeln: klare Vorgaben, Verbote und vor allem auch wirksame Mechanismen zu deren Durchsetzung. Besonders wichtig ist der effektive Schutz von Kindern und Jugendlichen. Ein echtes Problem sind zum Beispiel Videospiele mit Glückspielelementen wie Lootboxen. Kommerzielles Glückspiel hat im Kinderzimmer nichts verloren. Ich begrüße es, dass die EU-Kommission einen Vorschlag für einen Digital Fairness Act angekündigt hat, der den Schutz vor manipulativen kommerziellen Praktiken im digitalen Raum insgesamt verbessern soll. Wichtig ist, dass sich alle betroffenen Akteure mit ihren Perspektiven in die Debatte über den Digital Fairness Act einbringen. Die diesjährige Veranstaltung zum „Safer Internet Day“ bietet dafür ein gutes Forum. Ich bin überzeugt: Es liegt auch im Interesse der Digitalwirtschaft, dass es im Internet fair zugeht – und es klare Regeln gibt gegen Manipulation und Irreführung.“
Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst:
„Digitale Angebote eröffnen enorme Chancen – sie müssen aber fair, transparent und sicher gestaltet sein. Ziel ist ein digitaler Raum, in dem sich Menschen selbstbestimmt bewegen können und der zugleich ein sicherer Ort gerade auch für Kinder und Jugendliche ist. Unfaire Geschäftspraktiken, manipulative Designs und andere Risiken gilt es wirksam einzudämmen. Der Digital Fairness Act bietet die Chance, den bestehenden Rechtsrahmen zu vereinfachen und zu harmonisieren und so Verbraucherschutz, Vertrauen und Innovationsfähigkeit gleichermaßen zu stärken. Ebenso wichtig ist es, die Kompetenzen von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu stärken, damit sie Risiken erkennen und Angebote einordnen können und so souveräner im digitalen Raum agieren.“
Der digitale Alltag ist zunehmend durch personalisierte Angebote, komplexe Geschäftsmodelle sowie aufmerksamkeitsorientierte Designansätze geprägt. Vor diesem Hintergrund gilt es, Verbraucherinnen, Verbraucher sowie insbesondere Kinder und Jugendliche im Netz zu schützen und im selbstbestimmten und verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien zu unterstützen.
Die Europäische Kommission hat in diesem Zusammenhang einen „Digital Fairness Act“ angekündigt. Sie hat das digitale Verbraucherrecht in den letzten Jahren einer Eignungsprüfung unterzogen. Mit dem „Digital Fairness Act“ möchte die Europäische Kommission digitale Märkte fairer für Unternehmen und Verbraucher machen.
Der Safer Internet Day (SID) ist ein internationaler Aktionstag für ein sicheres und verantwortungsvolles Internet. Er findet jedes Jahr am zweiten Dienstag im Februar in über 180 Ländern statt. In Deutschland wird der Safer Internet Day von klicksafe koordiniert und von zahlreichen Akteurinnen und Akteuren aus Bildung, Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Politik mit Veranstaltungen und Aktionen begleitet.
Foto: © PWO
Politik
Fragen zu zivilen und militärischen Weltraumprogrammen
Berlin 10.02.2026
– Mit möglichen Synergien zwischen militärischen und zivilen Weltraumprogrammen befasst sich die AfD-Fraktion in einer Kleinen Anfrage (21/3988). Die Bundesregierung habe in ihrer Raumfahrtstrategie die Absicht erklärt, Synergien durch Dual-Use-Ansätze bei der Entwicklung neuer Technologien zu nutzen.
Das Ziel sei, die zivil-militärische Zusammenarbeit zu stärken, um gemeinsame Nutzungssynergien beim Betrieb und der Bereitstellung von Weltrauminfrastrukturen zu schaffen. Die Abgeordneten wollen von der Bundesregierung wissen, ob es Möglichkeiten gibt, Satelliten, die für die Bundeswehr genutzt werden, auch für zivile Zwecke einzusetzen.
Politik
Deutschland gewinnt internationalen KI-Preis
Berlin 04.02.2026
– Neue KI-Plattform beschleunigt Genehmigungsverfahren
Deutschland ist in Dubai beim World Government Summit für seinen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung geehrt worden. Ausgezeichnet in der Kategorie „Best Use of AI in Government Services“ wurde eine agentische KI, die Planungs- und Genehmigungsverfahren von Infrastrukturprojekten massiv beschleunigt und zugleich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung entlastet. Die KI wurde vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) entwickelt und durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) als zuständiges Ressort für den Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland initiiert und finanziert. Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger hat die Auszeichnung stellvertretend für Deutschland entgegengenommen.
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche:
„Diese Auszeichnung zeigt, welches Potenzial in einer intelligent modernisierten Verwaltung steckt. Mit der KI-Plattform beschleunigen wir komplexe Genehmigungsverfahren spürbar und schaffen bessere Rahmenbedingungen für zentrale Infrastrukturprojekte – insbesondere für den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. Entscheidend ist dabei: Der Staat wird schneller, effizienter und entlastet zugleich seine Beschäftigten. Genauso stärken wir Deutschlands wirtschaftliche Handlungsfähigkeit im internationalen Wettbewerb.“
Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung Dr. Karsten Wildberger:
„Dieser Preis unterstreicht: Deutschland kann bei KI in der Verwaltung in der ersten Liga mitspielen. Unsere technische Lösung nutzt sogenannte agentische KI und verkürzt Verfahren, die heute Monate dauern, auf Tage. Wir werden diese Technologie nun als Open-Source-Code bereitstellen und Stück für Stück im Land zur Nachnutzung anbieten. Damit schaffen wir eine Blaupause für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Genehmigungsverfahren und stärken gleichzeitig unsere digitale Souveränität.“
Massive Beschleunigung von Genehmigungsprozessen
Die prämierte Lösung ist eine universelle agentische KI, die für Planungs- und Genehmigungsverfahren für das Wasserstoff-Kernnetz entwickelt wurde und auf unterschiedliche Rechtsgebiete des Planungs- und Genehmigungsrechts sowie weitere Rechtsgebiete trainiert werden kann und damit universell einsetzbar ist. Ein erster Schwerpunkt liegt auf komplexen Infrastrukturvorhaben, bei denen bisher Sachbearbeitende hunderte Seiten Antragsunterlagen über Wochen oder Monate manuell prüfen mussten.
Stattdessen analysiert die KI, Antragsunterlagen in wenigen Stunden, strukturiert die Inhalte, prüft, ob erforderliche Nachweise vorliegen, und erstellt fundierte Entscheidungsvorschläge für die Bearbeitung. Die Entscheidung selbst bleibt bei den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sodass rechtliche Verantwortung und Ermessensspielräume rechtskonform weiterhin klar in menschlicher Hand liegen.
KI-Agenten sind bereits im Einsatz
Erste Agenten der prämierten KI-Lösung sind bereits in der Hansestadt Hamburg im Einsatz für die Genehmigung von Wasserstoff-Kernnetzleitungen. Aktuell werden im Sinne der Skalierung weitere Module der agentischen KI in Nordrhein‑Westfalen in Genehmigungsprozesse für Anträgen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) integriert. Parallel läuft ein Implementierungsprojekt mit dem Fernstraßen-Bundesamt.
BMWE und BMDS werden die KI-Agenten schrittweise als Open-Source-Lösung bereitstellen und so eine breite Nachnutzung in Bund, Ländern und Kommunen ermöglichen. Was einmal entwickelt wird, soll mehrfach wirken und so eine Blaupause für die Beschleunigung von komplexen Genehmigungsverfahren werden.
Politik
Cyber- und Sicherheitspakt: Deutschland und Israel proben den Ernstfall
Berlin 30.01.2026
– Premiere im Cyberraum: Deutschland und Israel haben erstmals gemeinsam die Abwehr eines schweren Cyberangriffs trainiert. Die Übung lief unter dem Namen BLUE HORIZON. Sie war der erste konkrete Schritt aus dem Cyber- und Sicherheitspakt, den Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Januar vereinbart haben.
Kern der Zusammenarbeit: der Aufbau eines deutschen Cyberdomes, angelehnt an das bewährte israelische Modell.
Bei der Übung arbeiteten Expertinnen und Experten der israelischen Nationalen Cyberdirektion Seite an Seite mit deutschen Cyber-Profis aus verschiedenen Behörden und Organisationen. Ziel: sich besser kennenlernen, Abläufe angleichen und eine gemeinsame Sprache für den Ernstfall entwickeln. Kurz gesagt: schneller reagieren, besser zusammenarbeiten, Angriffe früher stoppen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt:
„Mit der ersten gemeinsamen Cyber-Abwehrübung machen wir das Cybersicherheitspaket praktisch wirksam. Wir stärken unsere Fähigkeit, schwere Cyberangriffe abzuwehren. Diese Kooperation schafft echte Krisenkompetenz. Deutschland und Israel stehen Seite an Seite für starke, sichere Abwehrsysteme und den Aufbau eines deutschen Cyberdomes.“
Politik
Luftsicherheitsgesetz wird unterschiedlich bewertet
Berlin 27.01.2026 (hib/HAU)
– Die von der Bundesregierung geplante Novellierung des Luftsicherheitsgesetzes wird von Experten unterschiedlich bewertet. Bei einer öffentlichen Anhörung des Innenausschusses am Montag begrüßten Polizeivertreter ebenso wie der Flughafenverband ADV die im „Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Luftsicherheitsgesetzes“ (21/3252) geplanten strafverschärfenden Regelungen für das unbefugte Eindringen in die Sicherheitsbereiche von Flughäfen. Künftig soll mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden, wer vorsätzlich unberechtigt in die Luftseite an Flughäfen eindringt und dadurch die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs beeinträchtigt. Simon Gauseweg, Mitarbeiter am Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Völker- und Europarecht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt bewertet diese Strafverschärfung hingegen als insgesamt bedenklich und unverhältnismäßig.
Der Gesetzentwurf sieht weiterhin vor, dass die Länder bei der Bundeswehr im Wege der Amtshilfe um Unterstützung bei der Drohnenabwehr anfragen können. Gestrafft werden soll dabei auch der Weg der Entscheidungsfindung. Nach derzeitiger Rechtslage erfordert die Entscheidungsfindung über den Einsatz der Streitkräfte im Wege der Amtshilfe zur Verhinderung eines regionalen Katastrophennotstandes eine entsprechende Verständigung zwischen dem Verteidigungsminister und dem Bundesinnenminister. Künftig soll das Verteidigungsministerium allein über die Amtshilfeanfrage entscheiden können. Das Erfordernis einer Entscheidungsfindung im Benehmen mit dem Bundesministerium des Inneren soll entfallen.
Heiko Stotz vom Deutschen Bundeswehrverband begrüßte, dass nun die Handlungsmöglichkeiten der Bundeswehr gegen Drohnen im Rahmen der Amtshilfe erweitert werden sollen. Auch die Verlagerung der Einsatzentscheidung vom Minister zum Ministerium bewertete er als richtig. Dies ermögliche eine Straffung der Befehlskette, da Einsatzentscheidungen delegiert werden können, sagte Stotz. Eine Unterstützung der Bundeswehr im Rahmen der Amtshilfe bleibe auch mit dieser Neuregelung die Ausnahme und nicht der Regelfall, betonte er. Für die Gefahrenabwehr im Innern seien nach wie vor die Polizeibehörden von Bund und Ländern verantwortlich. Entscheidend sei, dass die Zusammenarbeit und die Kommunikation zwischen den Sicherheitsbehörden in der Praxis reibungslos funktionieren müsse.
Arnd Krummen von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) sieht „falsche Weichen bei der Drohnenabwehr gestellt“. So solle ein Einsatz der Bundeswehr schon „bei Lagen, die eindeutig polizeilich geprägt sind“ möglich sein. Der Wegfall des „ins Benehmen setzen“ mit dem BMI sei kritisch zu bewerten, befand er. Damit werde die verfassungsrechtlich bewusst hoch gesetzte Einsatzschwelle der Bundeswehr im Inland „faktisch abgesenkt“, sagte Krummen. Der Gesetzgeber, so der GdP-Vertreter, müsse perspektivisch prüfen, ob der bestehende verfassungsrechtliche Rahmen weiterentwickelt werden sollte. Eine solche Reform könne klar regeln, dass die Streitkräfte zur Unterstützung bei der Abwehr erheblicher Gefahren durch Drohnenüberflüge herangezogen werden können, „ohne die verfassungsrechtlich gebotene Trennung zwischen Polizei und Militär aufzuweichen“.
Auch aus Sicht von Gauseweg stößt die Gefahrenabwehr durch die Bundeswehr auf verfassungsrechtliche Bedenken. Der Streitkräfteeinsatz sei im System des Grundgesetzes die Ultima Ratio, sagte er. Nur in einem Fall „katastrophischen Ausmaßes“, bei dem die Polizei strukturell überfordert sei und die Lage unter keinen Umständen mehr beherrschen könne, sei an einen Hilfeeinsatz der Bundeswehr im Innern überhaupt zu denken.
Ralph Beisel, Hauptgeschäftsführer beim Flughafenverband ADV, bewertete hingegen die im Gesetzentwurf vorgesehenen Befugnisse der Bundeswehr zur Drohnenabwehr positiv. Jede Regelung, die effektive Maßnahmen zur Detektion und Abwehr von Drohnen ermöglicht, stärke die Resilienz gegen Störungen durch Drohnenflüge, sagte er. Dazu gehöre im definierten Rahmen und unter Beachtung grundgesetzlicher Vorgaben als Ultima Ratio der Einsatz der Bundeswehr – „auch an Flughäfen“. Dankbar zeigte sich Beisel angesichts der geplanten Strafverschärfung. Es sei schließlich kein Bagatelldelikt, „wenn man sich mit gewaltsamen Mitteln Zutritt in den Luftsicherheitsbereich eines Flughafens verschafft“.
Manuel Ostermann, stellvertretender Bundesvorsitzender der Bundespolizeigewerkschaft (DPolG), begrüßte ebenfalls die geplante Einführung eines eigenständigen Straftatbestandes für das vorsätzliche, unberechtigte Eindringen in die Sicherheitsbereiche von Flughäfen. Zugleich wies er darauf hin, dass die Bundespolizei im Sicherheitsverbund an Flughäfen regelmäßig als zentrale Akteurin benannt werde, „ihr jedoch im Bereich der Luftsicherheit bislang keine umfassenden Strafverfolgungskompetenzen zugewiesen werden“. Es sei weder sachgerecht noch effizient, die Bundespolizei mit erheblichen personellen und materiellen Ressourcen einzusetzen, gleichzeitig jedoch ein bürokratisches und in der Praxis eingeschränkt handlungsfähiges Zuständigkeitssystem aufrechtzuerhalten.
Die kommerziellen Drohnen dürften nicht automatisch unter Generalverdacht gestellt werden, betonte Gerald Wissel, Vorstandsvorsitzender der UAV DACH, dem Interessenverband der kommerziellen Drohnennutzer. Um tatsächlich Sicherheit für gefährdete Infrastrukturen zu erreichen, brauche es eine Gesamtlösung, sagte Wissel. Dazu sei ein einheitliches Luftlagebild im unteren Luftraum „in Echtzeit“ unerlässlich. Ohne sofortige Sichtbarkeit und eindeutige Unterscheidung zwischen legalem und illegalem und potentiell gefährlichem Betrieb bleibe jede Reaktionskette unzureichend. Zugleich brauche es eine klare Regelung der Verantwortlichkeiten bei BMI, Bundespolizei und den Einrichtungen und Behörden der Länder. Mit der geplanten Reform werde jedoch das Zuständigkeitschaos nicht gelöst, befand Wissel.
Berlin
Nationale Reserve schaffen, regulatorische Hürden abbauen, Redundanzen stärken
VKU fordert nach Berliner Stromausfall: Finanzierung über Sondermittel sicherstellen
Berlin 09.01.2026.
– Der über vier Tage andauernde Stromausfall in Teilen Berlins nach dem Anschlag auf die Strominfrastruktur zeigt: Die Versorgungssicherheit ist auch eine Frage der nationalen Sicherheit. Das Präsidium des Verbandes kommunaler Unternehmen (VKU) hat die Ereignisse beraten. VKU-Präsident Dr. Ulf Kämpfer fordert die Politik zum entschlossenen Handeln auf.
„Der Anschlag auf die Berliner Stromversorgung hat gezeigt: Unsere Energienetze sind verwundbar. Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit gegen derartige Anschläge. Wir müssen aber alles daransetzen, die Schäden zu begrenzen und die Versorgung so schnell wie möglich wiederherzustellen. Ziel einer nationalen Reserve und entsprechender Kriseninterventionsmaßnahmen im Großschadensfall muss sein, dass der Strom möglichst binnen 24 Stunden provisorisch wieder fließt. Denn ohne Energie steht alles still: Staat, Wirtschaft, Gesellschaft.“ so der VKU-Präsident und Kieler Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer.
Und weiter: „Berlin hat in dieser Ausnahmesituation gezeigt, wie professionell und engagiert die Netzbetreiber arbeiten. Die Kolleginnen und Kollegen von Stromnetz Berlin verdienen ausdrücklich Anerkennung für die geleistete Arbeit. Auch die Solidarität in der Branche über helfende Netzbetreiber aus dem ganzen Bundesgebiet war beeindruckend. Angesichts der geänderten Bedrohungslage und einer neuen Intensität von Anschlägen, die auch in der Zukunft nicht ausgeschlossen werden kann, stehen wir vor einer neuen nationalen Aufgabe. Klar ist, selbst bei bester Vorbereitung kann es keine absolute Sicherheit geben. Es geht nicht um technische Störungen, deren Behebung für Netzbetreiber alltägliche Arbeit ist, die sie hervorragend beherrschen. Es geht um gezielte Angriffe, die eine neue Dimension darstellen.“
Ziel: Stromversorgung möglichst binnen 24 Stunden wiederherstellen
Im Falle eines Großschadensereignisses sollte die Stromversorgung möglichst innerhalb von 24 Stunden nach Aktivierung der nationalen Reserve über einen provisorischen Inselnetzbetrieb wieder anlaufen können. Im Ernstfall zählt ausschließlich, dass der Strom so schnell wie möglich wieder fließt. Die Reparatur zerstörter Stromnetzinfrastruktur ist oftmals technisch und logistisch hochkomplex und kann erhebliche Zeit in Anspruch nehmen. Der Aufbau sogenannter Inselnetze mithilfe mobiler, schnell einsetzbarer dezentraler Stromerzeugung ist daher häufig die einzige Möglichkeit, kurzfristig eine Notversorgung sicherzustellen.
Vor diesem Hintergrund fordert der VKU einen klaren politischen Kurs für mehr Resilienz:
- Nationale Notfallreserve schaffen
Der VKU fordert in enger fachlicher Abstimmung mit den Netzbetreibern den zügigen Aufbau einer „Nationalen Reserve Blackout und Krisenintervention“. Mobile Netzersatzanlagen, Blockheizkraftwerke und Gasturbinen im Umfang von mehreren einhundert Megawatt Leistung müssen über Deutschland verteilt in regionalen Versorgungssicherheitshubs vorgehalten werden, um im Ernstfall möglichst binnen 24 Stunden eine Notversorgung zu ermöglichen. Ein „One-Stop-Shop“ für betroffene Netzbetreiber muss die Aktivierung der Reserve ohne Kompetenzstreitigkeiten mit nur einem Anruf ermöglichen. - Regulatorische Hürden abbauen
Im Krisenfall dürfen Kompetenzfragen ebenso wenig wie Haftungs-, Genehmigungs-, Kosten-, arbeitsrechtliche oder versicherungsrechtliche Aspekte die Wiederherstellung der Versorgung verzögern. Bestehende Regelungen müssen vor dem Hintergrund der Berliner Ereignisse und einer veränderten Bedrohungslage unverzüglich auf ihre Krisentauglichkeit überprüft werden.
Erforderlich sind klare, rechtssichere gesetzliche Regelungen für Netzanschluss und Betrieb im Notfall. Bürokratie darf nicht zum Risiko für die Versorgung werden. - Dezentralität, Redundanzen und Netzvermaschung stärken
Eine stärker dezentrale Energieversorgung basierend auf erneuerbaren Energien, Speichern und Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) sowie private und kommunale Vorsorgeoptionen (z. B. Speicher, Notstrom, Wärmequellen) können die Auswirkungen von Ausfällen erheblich abmildern. Der regulatorische Rahmen ist hierfür bislang nicht ausreichend krisenfest ausgestaltet. Zudem fehlt den Unternehmen Planungssicherheit, da unklar ist, ob Investitionen auch künftig über das Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) gefördert werden.
Um Ausfallrisiken und -dauer zu senken, müssen zusätzliche Redundanzen und eine stärkere Netzvermaschung systematisch geprüft werden. Dies erfordert eine enge Abstimmung zwischen Bundesnetzagentur, Landesregulierungsbehörden und Stromverteilnetzbetreibern sowie eine Anpassung der regulatorischen Anreize, damit Investitionen in die Resilienz der Netze wirtschaftlich tragfähig bleiben und nicht zulasten der Netzbetreiber gehen.
Finanzierung des Bundes sicherstellen
Die Umsetzung dieser Maßnahmen erfordert erhebliche Investitionen. Der VKU fordert, die Finanzierung über die nach Art. 109 Grundgesetz geschaffene Ausnahme von der Schuldenbremse für Landesverteidigung und Bevölkerungsschutz sowie aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität (SVIK) sicherzustellen.
„Resilienz ist keine rein technische Aufgabe der Netzbetreiber, sondern eine gesamtstaatliche Verantwortung. Auch jeder Einzelne ist gut beraten, selbst Vorsorge zu treffen.“, betont Kämpfer. „Wir brauchen klare Prioritäten, verlässliche rechtliche Rahmenbedingungen und eine enge Zusammenarbeit von Staat und kommunaler Wirtschaft.“
Politik
Digitalisierung von Führerscheinen und Fahrzeugpapieren
Berlin 09.01.2026
– Die Bundesregierung will Rechtsgrundlagen im Straßenverkehrsrecht für die Digitalisierung der fahrer- und fahrzeugbezogenen Papiere, für eine digitale Parkraumkontrolle sowie für einen digitalen Datenaustausch in der Verwaltung schaffen. Der dazu vorgelegte Entwurf „eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) und anderer straßenverkehrsrechtlicher Vorschriften“ (21/3505) dient laut Regierung auch dem Bürokratieabbau durch die Vereinfachung von Abläufen und Regeln sowie durch die Schaffung von zeitgemäßen digitalen Leistungen und den Zugang zu Daten in der Verwaltung. Nicht zuletzt leiste das Gesetz Beiträge zum Innovationsstandort für autonomes Fahren sowie zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, heißt es in der Vorlage.
Geplant ist, die bisherige partielle Rechtsgrundlage im StVG für eine temporäre digitale Zulassungsbescheinigung zu einer allgemeinen Regelung auszubauen. Ferner sollen die Rechtsgrundlagen zur Einführung des digitalen Führerscheins „als ergänzendes elektronisches Dokument zum Kartenführerschein“ geschaffen werden.
Nach den Vorstellungen der Bundesregierung soll die Effektivität von Parkraumkontrollen durch den Einsatz digitaler Mittel gesteigert werden. „Es wird eine fokussierte Rechtsgrundlage für die digitale Parkraumkontrolle geschaffen, um den Kommunen hier vertretbaren Handlungsspielraum zu geben“, heißt es im Entwurf.
Weiterhin soll eine formell-gesetzliche Grundlage im Sinne der Datenschutzgrundverordnung geschaffen werden, damit das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) Auskünfte aus den von ihm geführten Datenbanken anhand der Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) erteilen kann.
Zur Verhinderung des sogenannten Punktehandels – der Täuschung von Behörden über Beteiligte an mit Punkten bewerteten Verkehrsverstößen – soll ein Bußgeldtatbestand geschaffen werden, der bereits das gewerbsmäßige Angebot einer Täuschung der Behörden über die Beteiligung an einem nach dem Fahreignungsbewertungssystem mit Punkten bewerteten Verkehrsverstoß sanktioniert. Somit solle der Ablenkung von Ermittlungen wegen solcher Verkehrsverstöße entgegengewirkt werden, schreibt die Bundesregierung.
Politik
Justizcloud: Bund und Länder starten gemeinsames Vorhaben
Berlin 07.01.2026
– Bund und Länder haben eine Vereinbarung zur Entwicklung einer bundeseinheitlichen Justizcloud unterzeichnet. Mit der bundeseinheitlichen Justizcloud soll eine zukunftsfähige IT-Infrastruktur für die Justiz im Bund und in den 16 Bundesländern geschaffen werden. Eine erste lauffähige Version soll bis Anfang 2027 zur Verfügung stehen. Eine Machbarkeitsstudie wurde bereits im vergangenen Jahr erfolgreich durchgeführt.
Die Justizcloud baut auf der vorhandenen Infrastruktur der öffentlichen IT-Dienstleister auf. Es soll ein eigenes Justiznetz errichtet werden. Ziel ist es, die technologische Selbständigkeit der Justiz zu stärken. Die Justizcloud soll Einsparpotenziale realisieren und zugleich die tägliche Arbeit in der Justiz verbessern. Sie soll moderne, nutzerzentrierte Anwendungen, schnelle Softwareupdates und einen stabilen Betrieb ermöglichen.
In einem ersten Schritt soll über die Justizcloud das Gemeinsame Fachverfahren (GeFa) der Justiz an Gerichten in mehreren Ländern zur Verfügung gestellt werden. GeFa unterstützt die Mitarbeitenden in der Justiz beim Erfassen, Bearbeiten und Verwalten von Daten, beim Abrufen von Informationen sowie beim Erstellen von Dokumenten. Perspektivisch sollen alle derzeit entwickelten und neu entstehenden Fachverfahren gemeinsam in der Cloud betrieben werden: Bestehende Strukturen sollen nach Möglichkeit nicht migriert, sondern abgelöst werden (sog. Greenfield-Ansatz).
Die Projektleitung übernimmt ein Aufbaustab, der im Land Baden-Württemberg angesiedelt wurde. Der Bund und alle weiteren Bundesländer sind eng in das Projekt eingebunden. Der Aufbaustab besteht aus Fachleuten aus Justiz und IT-Branche. Aus dem Aufbaustab soll künftig eine Betriebsanstalt für die Justizcloud entstehen – die Justizcloud-Einheit. Der Justizcloud-Einheit fällt die Aufgabe zu, die bundeseinheitliche Justizcloud künftig für die gesamte Justiz zu betreiben.
Technik
BR-Studie zeigt: 82 Prozent der Deutschen suchen bereits mit KI
Berlin 18.12.2025
Die Art, wie wir im Internet nach Informationen suchen, verändert sich gerade grundlegend. Vor allem für junge Menschen ist die KI-Suche längst Alltag. Die neue BR-Studie „KI & Search“ zeigt, wie das die Spielregeln im Netz bereits verändert hat
Wer heute eine Frage hat und im Internet nach einer Antwort sucht, hat die Wahl: eine klassische Suchmaschine fragen und sich durch mehrere Websites klicken – oder einen Chatbot öffnen und in Sekunden eine Antwort bekommen. Immer mehr Menschen entscheiden sich für die zweite Variante. Die neue Studie „KI & Search“ der BR-Medienforschung in Zusammenarbeit mit ARD SEO zeigt nun erstmals, wie weitreichend diese Veränderung bereits ist. Für die repräsentative Erhebung wurden im Oktober 2025 insgesamt 1.200 Personen zwischen 16 und 69 Jahren
82 Prozent der 16- bis 69-Jährigen in Deutschland haben demnach schon einmal KI-Tools oder KI-Zusammenfassungen in Suchmaschinen zur Informationssuche genutzt. Bei den unter 30-Jährigen sind es sogar 94 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet das: 47 Millionen Menschen in Deutschland haben KI bereits für die Informationsbeschaffung verwendet.
Wie verändert KI unser Leben? Und welche KI-Programme sind in meinem Alltag wirklich wichtig? Antworten auf diese und weitere Fragen diskutieren Gregor Schmalzried, Marie Kilg und Fritz Espenlaub jede Woche in „Der KI-Podcast“ – dem Podcast von BR24 und SWR.
ChatGPT dominiert den Markt
Die Entwicklung geht hier schnell. 61 Prozent der Befragten greifen mittlerweile mindestens wöchentlich auf KI-generierte Inhalte zurück. Bei den Jüngeren unter 30 Jahren sind es sogar 87 Prozent – für sie ist die KI-Suche zur Routine geworden.
Das mit Abstand beliebteste Tool ist ChatGPT: 33 Prozent der Befragten nutzen es mindestens wöchentlich. Dahinter folgen Google Gemini mit 21 Prozent, Meta AI mit 16 Prozent und Microsoft Copilot mit 13 Prozent. Auch die „AI Overviews“ – also KI-generierte Zusammenfassungen, die Google seit Herbst 2025 direkt in den Suchergebnissen anzeigt – werden von 41 Prozent der Deutschen unter 70 Jahren regelmäßig genutzt.
Das Phänomen der „Zero-Klick-Suche“
Mit der neuen Technologie verändert sich auch das Verhalten der Nutzerinnen und Nutzer grundlegend. Immer häufiger endet eine Suche, ohne dass jemand auf einen weiterführenden Link klickt – Fachleute sprechen von „Zero-Klick-Suchen“. Die Studie liefert dazu erstmals konkrete Zahlen für Deutschland.
54 Prozent derjenigen, die KI-Zusammenfassungen in Suchmaschinen nutzen, geben an, bei höchstens der Hälfte ihrer Suchanfragen noch auf weiterführende Links zu klicken. Bei reinen KI-Tools wie ChatGPT ist der Effekt noch stärker: Hier klicken 75 Prozent der Nutzenden bei höchstens der Hälfte ihrer Anfragen auf Links – 44 Prozent tun dies sogar „selten oder nie“
Wikipedia und Blogs verlieren am stärksten
Die Auswirkungen auf klassische Websites sind bereits messbar. Am härtesten trifft es Wikipedia: 29 Prozent der Befragten geben an, die Online-Enzyklopädie seltener zu nutzen, seit es KI-Angebote gibt. Nur zehn Prozent nutzen sie häufiger. Auch Blogs und Foren verzeichnen deutliche Rückgänge: 22 Prozent weniger Nutzung steht hier nur neun Prozent mehr gegenüber.
Bei Nachrichtenwebsites fällt der Effekt etwas geringer aus. 16 Prozent nutzen die digitalen Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks seltener, bei privaten Nachrichtenanbietern sind es 19 Prozent. Allerdings geben auch jeweils rund zehn Prozent an, diese Angebote seit dem Aufkommen von KI häufiger zu nutzen.
Google plant den nächsten Schritt
Die Entwicklung dürfte sich in den kommenden Monaten weiter beschleunigen. Google rollt seit Oktober 2025 seinen neuen „AI Mode“ in Deutschland aus – eine erweiterte KI-Suche, die noch stärker auf generierte Antworten setzt. Laut der Studie können sich 15 Prozent der Befragten vorstellen, diesen Modus künftig als Standard-Suche zu nutzen. Weitere 31 Prozent wollen flexibel zwischen klassischer Suche und KI-Modus wechseln.
Die kleine Gruppe der KI-Verweigerer – 18 Prozent der Bevölkerung – dürfte hingegen kaum noch wachsen. Sie ist im Schnitt deutlich älter, verfügt über niedrigere Bildungsabschlüsse und steht digitalen Informationsquellen generell skeptisch gegenüber. Nur 13 Prozent dieser Gruppe zeigt sich offen, KI in Zukunft auszuprobieren.
Politik
Cybersicherheit des Bundeswirtschaftsministeriums
Berlin 21.11.2025
– Eine Kleine Anfrage (21/2406) der AfD-Fraktion mit dem Titel „Cybersicherheit und Stellenentwicklung im Bereich IT-Sicherheit im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie“ kann „nach sorgfältiger Abwägung“ der Bundesregierung „nicht durchgängig vollständig erfolgen“. Das schreibt die Bundesregierung in ihrer Antwort (21/2844) auf die Anfrage der AfD-Abgeordneten.
Die IT-Infrastruktur der Bundesregierung sei jeden Tag Angriffen ausgesetzt. Zur Aufrechterhaltung der Staats- und Regierungsfunktion sei diese Infrastruktur angemessen zu schützen, heißt es in der Antwort. Durch die Veröffentlichung sensibler Informationen wäre die in langjährigen Prozessen erarbeitete Resilienz der Informationstechnik des Bundes erheblich gefährdet. Informationen zu Anzahl, Ort und Ausstattung von Rechenzentren des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE), Ergebnissen technischer Sicherheitsüberprüfungen, Anzahl registrierter Sicherheitsvorfälle oder Cyberangriffen, ergriffener und in Planung befindlicher technischer und organisatorischer Maßnahmen gegen Cyberangriffe, der Anzahl von Stellen in der IT-Sicherheit und deren Entwicklung bezögen sich unmittelbar auf die Fähigkeiten der Abwehr von Cybergefährdungen der Bundesbehörden. Ein Bekanntwerden der detaillierten Information würde das Staatswohl gefährden, denn damit würde es etwaigen Angreifern ermöglicht, konkrete Hinweise zu den im BMWE eingesetzten Schutzmaßnahmen zu erhalten.
Politik
Neue Weltraum-Sicherheitsstrategie der Bundesregierung

Berlin 20.11.2025
– Die Bundesregierung hat ihre erste Weltraumsicherheitsstrategie vorgestellt. Weltraumsysteme sind mittlerweile ein fester Bestandteil unseres Lebens. Wir profitieren von den weltraumgestützten Diensten im Alltag, etwa bei Kommunikation und Navigation. Auch unsere Unternehmen und die Bundeswehr sind unter anderem auf diese Dienste angewiesen. Ein Ausfall oder eine Störung hätten gravierende Auswirkungen auf unsere Sicherheit und unseren Alltag. Wir erleben bereits heute, dass zum Beispiel Russland regelmäßig das GPS-Signal im Ostseeraum stört. Die Weltraumsicherheitsstrategie setzt den Rahmen dafür, wie wir uns im All besser schützen und verteidigen sowie gesamtstaatlich resilienter aufstellen können. Die Bundeswehr bildet dabei das Rückgrat der nationalen Weltraumsicherheitsarchitektur, sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius.
Foto: © PWO
-

 Berlin3 Tagen ago
Berlin3 Tagen agoEntlastung der Sozialverwaltungen
-
Politik3 Tagen ago
Lars Klingbeil zum russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine
-
Politik3 Tagen ago
Neuer Deutschlandtakt: Nahverkehrausbau statt „Tempo 300“
-
Politik3 Tagen ago
Vier Jahre Russisch-Ukrainischen Krieg, ein Presseüberblick
-
Politik3 Tagen ago
Ministerkomitee des Europarats sichert weitere Unterstützung der Ukraine zu
-
Politik3 Tagen ago
Projekt-Arbeitsgruppe zum autonomen Fahren in Modellregionen
-
Welt3 Tagen ago
Deutsch-Chinesische Handelsbeziehung
-
Wirtschaft3 Tagen ago
Anteil ausländischer Ärzte gestiegen
-
Berlin3 Tagen ago
Goldener Bär für İlker Çatak
-
Wirtschaft3 Tagen ago
ifo Geschäftsklimaindex gestiegen
-
Politik3 Tagen ago
Grenzüberschreitende Konflikte und der Schiedsgerichtshof bei der DIHK
-
Kunst3 Tagen ago
Vier Jahre Krieg gegen die Ukraine
-
Politik3 Tagen ago
Bundeskanzler Friedrich Merz bei Xi Jinping
-
Politik3 Tagen ago
Anhörung zur Grundsicherung 2026
-
Wirtschaft3 Tagen ago
ifo Institut: Unternehmen bauen wieder mehr Stellen ab