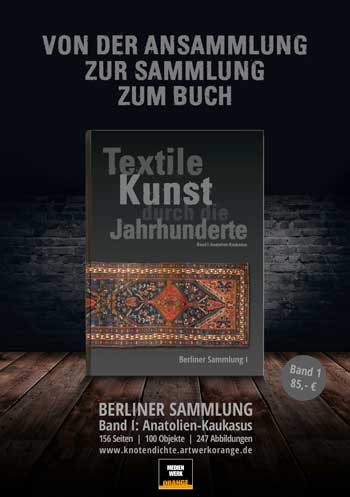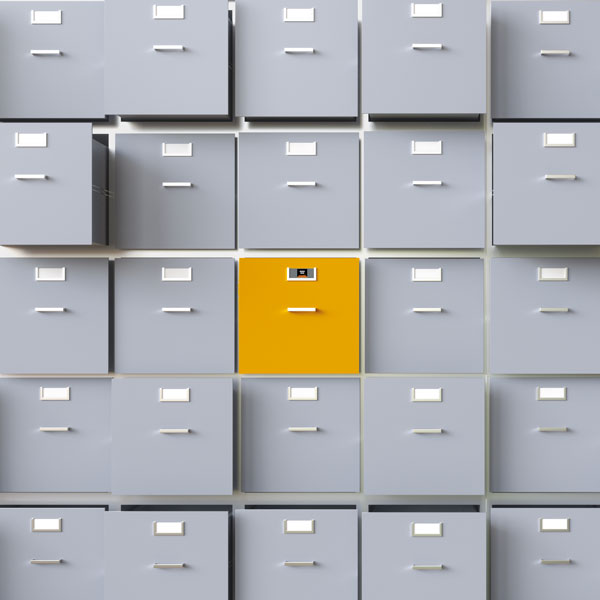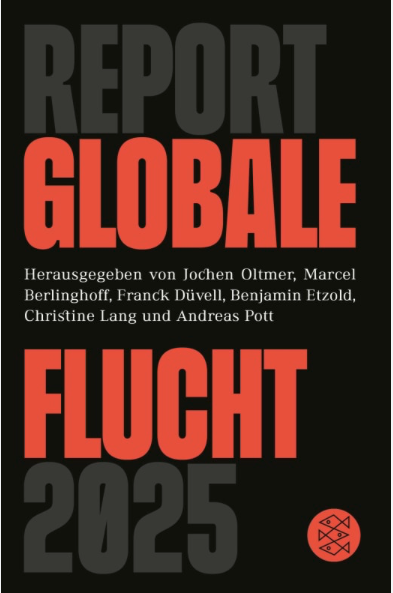Politik
Batterierechts-Anpassung: Experten mahnen Änderungen an
Berlin 02.09.2025
– Der Gesetzentwurf der Bundesregierung (21/1150) zur Anpassung des Batterierechts an die EU-Verordnung 2023/1542 (Batterierecht-EU-Anpassungsgesetz) sowie der wortgleiche Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU/CSU und SPD (21/570) sind bei Sachverständigen auf ein geteiltes Echo gestoßen. In einer öffentlichen Anhörung des Umweltausschusses am Montag signalisierten insbesondere die von der Unionsfraktion benannten Experten Zweifel gegenüber dem Gesetzentwurf und kritisierten vor allem, dass er weit über die Vorgaben der EU-Batterieverordnung hinausgehe.
Die jeweils von den Fraktionen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke benannten Sachverständigen wiederum begrüßten den Gesetzentwurf grundsätzlich. Allerdings sprachen sie sich ihrerseits für weitergehende oder zusätzliche Regelungen aus. So löse der vorliegende Entwurf zum Beispiel die Problematik der Brände, die durch Lithium-Akkus und -Batterien verursacht werden, weiterhin nicht.
Der Gesetzentwurf soll laut Vorlage die EU-Vorgaben zu Produktion, Kennzeichnung, Entsorgung und Recycling von Batterien in nationales Recht überführen. Die Verordnung regelt unter anderem Beschränkungen für gefährliche Stoffe, Design- und Kennzeichnungsvorgaben, Konformität, Sorgfaltspflichten in der Lieferkette sowie die Sammlung und Behandlung von Altbatterien. Außerdem ist in der EU-Batterieverordnung eine Anhebung der Sammelziele für Gerätebatterien auf 63 Prozent bis Ende 2027 und auf 73 Prozent bis Ende 2030 vorgesehen; bis dahin bleibt es bei der in Deutschland geltenden Quote von 50 Prozent.
Das bisherige Batteriegesetz (BattG) soll aufgehoben und durch ein neues Batterierecht-Durchführungsgesetz (BattDG) ersetzt werden. Dieses enthält unter anderem Pflichten zur Einrichtung kollektiver Sammelsysteme für alle Batteriekategorien, zur Hinterlegung von Sicherheitsleistungen sowie zur Rückgabe ausgedienter Batterien von E-Bikes oder E-Scootern an kommunalen Sammelstellen.
Tim Bagner vom Deutschen Städtetag unterstützte als Vertreter der kommunalen Spitzenverbände, dass mit dem Gesetz nun auch Hersteller von Starter-, Industrie- und Elektrofahrzeugbatterien zu einer Beteiligung an einer Organisation für Herstellerverantwortung verpflichtet werden sollen. Kritisch sehe die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände aber die geplante Bindungsfrist der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger von mindestens zwölf Monaten an eine Organisation der Herstellerverantwortung. Um eine gesicherte Abnahme von Altbatterien zu erreichen, müsse es möglich sein, die Herstellerorganisation kurzfristig zu wechseln, so Bagner. Nur so könne eine Zwischenlagerung von Geräte- und LV-Batterien, die bereits in der Vergangenheit zu Problemen geführt habe, vermieden werden.
Holger Thärichen vom Verband kommunaler Unternehmen unterstützte das Vorhaben, dass künftig mehr Batterietypen an kommunalen Sammelstellen entgegengenommen werden sollen. Für die Unternehmen sei das zwar eine Herausforderung, aber private Haushalte brauchten eine Möglichkeit zur Entsorgung etwa von ausgedienten E-Bike-Batterien. Damit an den Sammelstellen ausreichend Spezialbehälter zur Verfügung stünden, um die „durchaus gefahrenrelevanten“ Batterien anzunehmen, plädierte Thärichen allerdings dafür, die Rücknahmepflicht der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger für Low-Voltage-Batterien (LV-Batterien), wie sie auch in E-Bikes verwendet werden, erst zum 1. Januar 2026 in Kraft zu setzen.
Auf das Problem von Bränden, die durch falsch entsorgte Lithium-Ionen-Akkus verursacht werden, machte Anja Siegesmund vom Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE) aufmerksam. Die Brände gefährdeten zunehmend die Funktionsfähigkeit der deutschen Recycling- und Entsorgungsinfrastruktur. In dem aktuellen Gesetzgebungsvorhaben sei das Thema aber ein „blinder Fleck“. Siegesmund sprach sich dafür aus, Batterierecht und Elektrogerätegesetzgebung „zusammen neu zu denken“. Es brauche einen integrierten Ansatz aus vorbeugenden Maßnahmen, verbindlichen Rücknahmeregeln und finanziellen Absicherungen. „Die Lage ist wirklich akut“, sagte die Expertin. Der BDE gehe von 30 Bränden pro Tag aus, die Branche schätze „die jährlichen Gesamtschäden durch Batterien in einer hohen dreistelligen Millionenhöhe“, heißt es dazu in der schriftlichen Stellungnahme der Sachverständigen. Kaum ein Versicherer sei mehr zur Absicherung der Risiken bereit. Der BDE fordere deshalb die Einführung eines „wirksamen Pfandsystems“ für lose Lithium-Akkus und -Batterien sowie Geräte mit eingebauten Lithium-Batterien, so Siegesmund.
Keinen dringenden Handlungsdruck sah wiederum Georgios Chryssos von der Stiftung Gemeinsames Rücknahmesystem Batterien (GRS). Die europäische Batterie-Verordnung gelte bereits seit dem 18. August und sei aufgrund „sehr klarer Vorgaben auch direkt und ohne Durchführungsgesetz vollziehbar“. Es gebe keine „akute Vollzugslücke, die durch eine überhastete Verabschiedung“ geschlossen werden müsse. Im Gegenteil: Chryssos warnte davor, den Gesetzentwurf wie vorgelegt zu beschließen. Er gehe weit über EU-Vorgaben hinaus und schaffe europaweit einmalige Zusatzpflichten ohne erkennbaren Mehrwert für Umwelt oder höhere Sammlungsquoten. Besonders in der Kritik des Sachverständigen: die fehlende Einbindung der Hersteller. Anders als Elektrogesetz und Verpackungsgesetz sehe der Entwurf keine Gemeinsame Herstellerstelle (GHS) vor, die mit „Branchen- und Sachkompetenz“ etwa bei Brandrisiken durch Lithium-Batterien praxisgerechte Lösungen gemeinsam mit Marktakteuren und Behörden erarbeiten könne. „Völlig an den Marktrealitäten vorbei“ gehe die zudem geplante Einführung einer zentralen, behördlich gesteuerten Abholung für Industrie-, Starter- und Fahrzeugbatterien. Mehr als 100.000 Sammelstellen müssten mit zwölf verschiedenen Gefahrgutbehältern ausgestattet werden – das sei in keinem anderen EU-Mitgliedstaat so geplant, unterstrich der Experte. Deutschland drohe zu einem bürokratischen Negativbeispiel in der EU zu werden.
Ähnlich äußerte sich Gunther Kellermann vom Verband der Elektro- und Digitalindustrie (ZVEI): Das „Goldplating“ benachteilige zwar vom Prinzip her keinen Batteriehersteller in Deutschland per se, aber es werde die Bewirtschaftung von Altbatterien komplizierter, aufwändiger und teurer machen als es die europäische Batterie-Verordnung eigentlich vorsehe, argumentierte der Sachverständige. Die Verordnung fordere zum Beispiel bei der Beitragsmessung lediglich zwei Kriterien. Die im Gesetzentwurf der Bundesregierung geplanten acht Kriterien machten die Beitragsmessung dagegen intransparent. Hersteller könnten die Beiträge nicht mehr vergleichen. Auch das Kriterium des CO2-Fußabdrucks werde deutsche Hersteller gegenüber anderen benachteiligen, so Kellermanns Einschätzung.
Grundsätzliche Kritik an dem Gesetzentwurf übte auch der von der AfD benannte Sachverständige Reinhard Müller-Syhre von der Gesellschaft für Fortschritt in Freiheit. In seiner schriftlichen Stellungnahme listet Müller-Syhre unter anderem die Kosten einer Vielzahl aufgrund des geplanten Gesetzes ausgelöster „bürokratischer Aktionen“ auf, die seines Erachtens zum „Gegenteil“ dessen führten, was das Gesetz „propagiert oder beabsichtigt.“ Auf Staat und Hersteller komme ein „gigantischer Moloch“ an Bürokratie zu. Das sei „innovationsfeindlich“, warnte Müller-Syhre in der Anhörung.
Antje Gerstein vom Handelsverband Deutschland (HDE) betonte, die Batterierücknahme im Handel sei bereits seit Jahren gelebte Praxis und habe sich bewährt. Die geplante Rücknahmepflicht von LV-Batterien und insbesondere ihre sach- und brandschutzgerechte Lagerung stelle aber die Unternehmen vor Herausforderungen. Zwar sei es begrüßenswert, dass nur jene Batteriekategorien zurückgenommen werden müssten, die die Unternehmen auch verkauften. Auch die Gewichtsgrenze von 45 Kilogramm sei praktikabel – zumindest für unbeschädigte LV-Batterien. Für die Rücknahme von sichtbar beschädigten Batterien, forderte Gerstein jedoch Ausnahmeregelungen. Diese sollen durch Wertstoffhöfe zurückgenommen werden, wo geschultes Fachpersonal Brandrisiken erkennen und minimieren könne.
Dem pflichtete der als Einzelsachverständiger von der Linksfraktion benannte Uwe Feige vom Kommunalservice Jena bei: Es sei tatsächlich fraglich, ob „Sicherheit und Hygiene“ in einem Handel, der für Lebensmittel organisiert sei, ausreiche. Wenn zudem ein Pfandsystem für Batterien gefordert werde, müsse gleichzeitig über den Vollzug gesprochen werden, „insbesondere beim Onlinehandel“.
Auf eine andere „Schwachstelle“ des Gesetzentwurfs wies Marieke Hoffmann von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) hin. Ihr zufolge sieht die Umweltorganisation die Gefahr, dass Hersteller mit besonders umweltschädlichen Batterien höhere Gebühren umgehen, indem sie ihre Herstellerverantwortung individuell wahrnehmen. Aus diesem Grund brauche es eine Systembeteiligungspflicht für Hersteller, so Hoffmann, denn nur durch kollektive Rücknahmesysteme könnten wichtige Regelungen der EU-Batterieverordnung wirksam umgesetzt werden. Nach Auffassung der DUH setzt der Gesetzentwurf so Mechanismen der sogenannten Ökomodulation in Paragraf 10 „völlig unzureichend um“. Positive Umwelteffekte drohten zu verpuffen, so die Sachverständige. Skeptisch sieht der Umweltverband auch, ob mit der „aktuellen Systematik“ des Gesetzes, die von der EU vorgegebenen Sammelziele erreicht werden können. Das deutsche System belohne aktuell Organisationen für Herstellerverantwortung, die Sammelquoten „immer nur gerade so“ einhalten, kritisierte die Sachverständige. Die DUH spreche sich daher für verbindliche nationale Zwischenziele aus. Besser wären aber Anreize, damit „immer so viel wie möglich“
Politik
Regierungsentwurf zum Schutz vor SLAPP-Verfahren
Berlin 04.02.2026
– Die Bundesregierung hat den Entwurf eines Gesetzes „zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2024/1069 über den Schutz von Personen, die sich öffentlich beteiligen, vor offensichtlich unbegründeten Klagen oder missbräuchlichen Gerichtsverfahren“ (21/3942) vorgelegt. Ziel des Gesetzentwurfs ist es, Personen, die sich am öffentlichen Meinungsbildungsprozess beteiligen, besser vor solchen Verfahren zu schützen, die als sogenannte SLAPP-Verfahren bezeichnet werden.
Die Frist zur Umsetzung der entsprechenden EU-Richtlinie läuft nach Angaben der Bundesregierung bis zum 7. Mai 2026. Kern des Entwurfs sind Änderungen der Zivilprozessordnung. Zwar trügen insbesondere die geltenden Kostenregelungen des Zivilverfahrensrechts bereits wesentlich zum effektiven Schutz vor missbräuchlichen Gerichtsverfahren in Deutschland bei, führt die Bundesregierung aus. Dennoch seien zur Umsetzung der Richtlinie einzelne Anpassungen im Zivilprozessrecht erforderlich. „Das betrifft namentlich die Möglichkeit der weitergehenden Kostenerstattung zugunsten betroffener Beklagter, die Ausweitung der Verpflichtung zur Leistung von Prozesskostensicherheit sowie Möglichkeiten weitergehender gerichtlicher Sanktionen oder vergleichbar wirksamer Maßnahmen bei missbräuchlich angestrengten Rechtsstreitigkeiten“, heißt es dazu.
Vorgesehen ist, in der Zivilprozessordnung einen neuen Abschnitt zu „missbräuchlichen Verfahren gegen Personen aufgrund ihrer Beteiligung am öffentlichen Meinungsbildungsprozess“ einzufügen, der unter anderem ein Vorrang- und Beschleunigungsgebot für entsprechende Verfahren vorsieht. Ergänzend sind Folgeänderungen im Arbeitsgerichtsgesetz und im Gerichtskostengesetz geplant. Rechtskräftige Urteile in solchen Verfahren sollen zudem anonymisiert oder pseudonymisiert veröffentlicht werden.
Das Kabinett hatte den Gesetzentwurf am 10. Dezember 2025 beschlossen. Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 30. Januar 2026 entschieden, gegen den Entwurf keine Einwendungen zu erheben.
Politik
Deutschland gewinnt internationalen KI-Preis
Berlin 04.02.2026
– Neue KI-Plattform beschleunigt Genehmigungsverfahren
Deutschland ist in Dubai beim World Government Summit für seinen Einsatz von Künstlicher Intelligenz in der Verwaltung geehrt worden. Ausgezeichnet in der Kategorie „Best Use of AI in Government Services“ wurde eine agentische KI, die Planungs- und Genehmigungsverfahren von Infrastrukturprojekten massiv beschleunigt und zugleich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung entlastet. Die KI wurde vom Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung (BMDS) entwickelt und durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) als zuständiges Ressort für den Aufbau der Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland initiiert und finanziert. Bundesdigitalminister Dr. Karsten Wildberger hat die Auszeichnung stellvertretend für Deutschland entgegengenommen.
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche:
„Diese Auszeichnung zeigt, welches Potenzial in einer intelligent modernisierten Verwaltung steckt. Mit der KI-Plattform beschleunigen wir komplexe Genehmigungsverfahren spürbar und schaffen bessere Rahmenbedingungen für zentrale Infrastrukturprojekte – insbesondere für den Aufbau der Wasserstoffwirtschaft. Entscheidend ist dabei: Der Staat wird schneller, effizienter und entlastet zugleich seine Beschäftigten. Genauso stärken wir Deutschlands wirtschaftliche Handlungsfähigkeit im internationalen Wettbewerb.“
Bundesminister für Digitales und Staatsmodernisierung Dr. Karsten Wildberger:
„Dieser Preis unterstreicht: Deutschland kann bei KI in der Verwaltung in der ersten Liga mitspielen. Unsere technische Lösung nutzt sogenannte agentische KI und verkürzt Verfahren, die heute Monate dauern, auf Tage. Wir werden diese Technologie nun als Open-Source-Code bereitstellen und Stück für Stück im Land zur Nachnutzung anbieten. Damit schaffen wir eine Blaupause für den Einsatz von künstlicher Intelligenz in Genehmigungsverfahren und stärken gleichzeitig unsere digitale Souveränität.“
Massive Beschleunigung von Genehmigungsprozessen
Die prämierte Lösung ist eine universelle agentische KI, die für Planungs- und Genehmigungsverfahren für das Wasserstoff-Kernnetz entwickelt wurde und auf unterschiedliche Rechtsgebiete des Planungs- und Genehmigungsrechts sowie weitere Rechtsgebiete trainiert werden kann und damit universell einsetzbar ist. Ein erster Schwerpunkt liegt auf komplexen Infrastrukturvorhaben, bei denen bisher Sachbearbeitende hunderte Seiten Antragsunterlagen über Wochen oder Monate manuell prüfen mussten.
Stattdessen analysiert die KI, Antragsunterlagen in wenigen Stunden, strukturiert die Inhalte, prüft, ob erforderliche Nachweise vorliegen, und erstellt fundierte Entscheidungsvorschläge für die Bearbeitung. Die Entscheidung selbst bleibt bei den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sodass rechtliche Verantwortung und Ermessensspielräume rechtskonform weiterhin klar in menschlicher Hand liegen.
KI-Agenten sind bereits im Einsatz
Erste Agenten der prämierten KI-Lösung sind bereits in der Hansestadt Hamburg im Einsatz für die Genehmigung von Wasserstoff-Kernnetzleitungen. Aktuell werden im Sinne der Skalierung weitere Module der agentischen KI in Nordrhein‑Westfalen in Genehmigungsprozesse für Anträgen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) integriert. Parallel läuft ein Implementierungsprojekt mit dem Fernstraßen-Bundesamt.
BMWE und BMDS werden die KI-Agenten schrittweise als Open-Source-Lösung bereitstellen und so eine breite Nachnutzung in Bund, Ländern und Kommunen ermöglichen. Was einmal entwickelt wird, soll mehrfach wirken und so eine Blaupause für die Beschleunigung von komplexen Genehmigungsverfahren werden.
Politik
Bemühungen zur Reintegration von Transnistrien
Berlin 03.02.2026
– Die OSZE-Mission in Moldau umfasst 52 Mitarbeiter, darunter 39 lokale Missionsmitarbeiter und 13 internationale Vertreter. Die Ausgaben für die Mission beliefen sich 2025 auf rund 2,3 Millionen Euro, wie aus der Antwort (21/3820) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (21/3424) der Linksfraktion hervorgeht.
Seit Beginn der Mission 1993 habe nahezu durchgehend mindestens ein deutscher Mitarbeiter für sie gearbeitet. Seit 2024 sei eine Deutsche stellvertretende (und seit Sommer 2025 amtierende) Missionsleiterin, heißt es in der Antwort weiter.
Die Bundesregierung unterstützt den Angaben zufolge die Bemühungen der moldauischen Regierung zur Reintegration des abtrünnigen Teils des Staatsgebietes, Transnistrien. Deutschland sei dazu gemeinsam mit anderen Partnern in verschiedenen Dialogforen aktiv.
Zudem unterstütze die Bundesregierung die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft durch die Entsendung von Mitarbeitern in verschiedene internationale Missionen in Moldau. So sei ein Außenamtsmitarbeiter als Sonderbeauftragter des amtierenden OSZE-Vorsitzes für die Beilegung der Transnistrien-Frage tätig.
Die OSZE-Mission in Moldau sei mandatiert, auf dem gesamten Gebiet der Republik Moldau tätig zu sein. Unabhängig davon versuche die transnistrische Seite, den Zugang teilweise zu kontrollieren oder einzuschränken. Die Bundesregierung setze sich nachdrücklich für die uneingeschränkte Ausübung des Mandats der OSZE-Mission in der Republik Moldau ein.
Politik
Einstieg des Bundes bei TenneT Germany
Berlin 04.02.2026
– Die KfW hat am 3. Februar im Auftrag der Bundesregierung den Vertrag zum Erwerb eines Anteils von 25,1% an der TenneT Germany von der niederländischen TenneT Holding unterzeichnet. Mit über 14.000 Trassenkilometern betreibt TenneT Germany das größte deutsche Strom-Übertragungsnetz.
Mit dieser Minderheitsbeteiligung wird der Bund gemäß seiner Anteile Einflussmöglichkeiten auf die TenneT Germany erhalten. Neben Mitbestimmungsrechten in Bezug auf die Geschäftsführung und den Geschäftsplan des Unternehmens kann der Bund beispielsweise stimmberechtigte Vertreterinnen bzw. Vertreter in das Gesellschafter- und Aufsichtsgremium entsenden.
Bundesministerin Katherina Reiche:
„Für das Erreichen der energiepolitischen Ziele ist der bedarfsgerechte Ausbau der Stromnetze erforderlich. Der Einstieg des Bundes bei Tennet trägt dazu bei, den milliardenschweren Kapitalbedarf in den kommenden Jahren abzusichern. Mit dieser Investition in die Infrastruktur der Zukunft stärken wir den Standort Deutschland.“
KfW-Vorstandsvorsitzender Stefan Wintels:
„Diese Beteiligung ist ein Meilenstein für Versorgungssicherheit und Resilienz der deutschen und europäischen Energieinfrastruktur. Mit unserer Beteiligung im Auftrag des Bundes und gemeinsam mit drei weiteren institutionellen Investoren leisten wir einen wichtigen Beitrag für langfristige Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum. Das Volumen der Transaktion unterstreicht die Attraktivität Deutschlands als Wirtschafts- und Investitionsstandort und zeigt, wie staatliches und institutionelles Kapital verantwortungsvoll zusammenwirkt. Wir freuen uns, den Bund bei diesem wichtigen Vorhaben mit unserer Expertise zu unterstützen.“
Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte bereits in seiner Sitzung am 16. Januar die entsprechenden Haushaltsmittel entsperrt und so den Weg für die Unterzeichnung freigemacht. Der Bund sichert dabei durch eine Risikoübernahme den Anteilserwerb durch die KfW und die zugesagten Kapitaleinlagen ab, ohne dass dafür Mittel aus dem Bundeshaushalt abfließen. Die Refinanzierungs- und Verwaltungskosten der KfW dagegen werden aus dem Bundeshaushalt getragen. Die Angemessenheit des Kaufpreises wurde unter anderem durch die Einholung zweier sogenannter Fairness Opinions geprüft. Die Wirtschaftlichkeit der Beteiligung wurde zudem durch entsprechendes Gutachten bestätigt.
Im September 2025 hatte die niederländische Regierung bekannt gegeben, dass der norwegische Staatsfonds Norges, der niederländische Pensionsfonds APG sowie der singapurische Staatsfonds GIC bis 2029 Anteile in Höhe von insgesamt bis zu 46 % an TenneT Germany erwerben wollen. Die privaten Investoren haben ebenfalls Kapitaleinlagen von bis zu € 9,50 Mrd. zugesagt. Der Bund wird seinen Anteil von 25,1% an TenneT Germany zur gleichen Kaufpreis-Bewertung erwerben wie die Mitinvestoren. Der übrige Anteil verbleibt bei der niederländischen TenneT Holding.
Wie bei Unternehmensbeteiligungen üblich müssen nun noch regulatorische Genehmigungen eingeholt werden, um den Erwerb der TenneT Germany Anteile vollziehen zu können. Mit diesem Schritt wird derzeit spätestens im dritten Quartal 2026 gerechnet. Neben den bereits bestehenden Beteiligungen des Bundes über die KfW an 50Hertz (20 %) und TransnetBW (24,95 %) wäre der Bund dann an drei der vier deutschen Stromübertragungsnetzbetreiber beteiligt.
Politik
Straße von Hormus
Berlin 04.02.2026
– Was würde geschehen, wenn der Iran die Straße von Hormus sperren würde?
Angesichts der eskalierenden militärischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran rückt die Straße von Hormus wieder in den Vordergrund – als wichtiger Engpass für die globalen Energiemärkte und strategisches Druckmittel, das die Spannungen von politischer Rhetorik zu einem weitreichenden internationalen Wirtschaftsschock eskalieren lassen kann.
Diese Wasserstraße war nie nur eine Passage für Schiffe; sie war historisch mit bedeutenden Konflikten am Golf verbunden, wie ein Bericht von Suhaib Al-Asa auf Al Jazeera verdeutlicht. Er erinnert an die Jahre des Iran-Irak-Krieges, als die Straße zum offenen Schlachtfeld für Tanker wurde.
In jenen Jahren wurden Öltanker von beiden Seiten angegriffen, was zu massiven Störungen der Schifffahrt und Rekordpreisen für Öl führte. Dies festigte die Position der Straße als zentraler politischer und wirtschaftlicher Punkt, dessen Brisanz mit jeder neuen militärischen Eskalation zunahm. Die Straße von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und dem Arabischen Meer. Die Straße von Hormus erstreckt sich über rund 180 Kilometer, ist an ihrer schmalsten Stelle maximal 33 Kilometer breit und bis zu 60 Meter tief und ermöglicht so die Durchfahrt für die größten Öltanker.
Die Straße besteht aus zwei jeweils 3 Kilometer breiten Schifffahrtswegen, die durch eine Pufferzone getrennt sind. Ihre Hoheitsgewässer unterstehen der Hoheitsgewalt Irans und Omans. Täglich passieren rund 21 Millionen Barrel Öl die Straße, was etwa 21 % des weltweiten Ölhandels entspricht. Die Bedeutung dieser Zahlen reicht jedoch weit über Öl hinaus: Mehr als 20 % des weltweiten Handels mit Flüssigerdgas (LNG) werden ebenfalls durch die Straße transportiert. Damit ist sie eine lebenswichtige Ader für die Energiesicherheit in Asien, insbesondere für China, Indien, Japan und Südkorea, sowie für Europa. Eine vollständige Schließung der Straße von Hormus könnte die Ölpreise innerhalb weniger Tage auf 200 US-Dollar pro Barrel treiben, mit explodierenden Kosten für die Schiffsversicherung und einer gravierenden Versorgungsknappheit – ein Szenario, das die globalen Energiemärkte erschüttern würde. Militärisch gesehen gilt die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten als rote Linie. Jede Sperrung könnte daher eine direkte militärische Intervention auslösen, obwohl der Iran selbst für seine Ölexporte und lebenswichtigen Importe auf die Straße angewiesen ist.
In den Jahren erhöhter Spannungen drohte Teheran wiederholt damit, die Straße als Druckmittel einzusetzen, wie beispielsweise 2019 mit Angriffen auf Tanker im Golf von Oman und der Beschlagnahmung von Handelsschiffen. Anschließend intensivierte der Iran seine Marinepatrouillen und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen.
Militärischen Einschätzungen zufolge nutzt der Iran unkonventionelle Methoden, um den Schiffsverkehr zu stören. Dazu gehören Tausende von Seeminen, mit Raketen und Torpedos bestückte Schnellboote, Kamikaze-Drohnen und Störtechnologien, die globale Navigationssysteme lahmlegen. Mit diesen Mitteln verwandelt sich die Straße von Hormus von einer lebenswichtigen Energieroute in ein potenzielles Schlachtfeld, auf dem militärische Kalkulationen mit der Weltwirtschaft verwoben sind – in einer offenen Konfrontation, deren Grenzen und Ausgang schwer vorherzusagen sind.
Politik
Angriffe gegen Kunst durch die Mullahs Regime
Berlin 02.02.2026
– Die Festnahme von Mehdi Mahmoudian ist kein Einzelfall, sondern Teil eines Systems, das kritische Stimmen gezielt zum Schweigen bringen will. Wer Autorinnen und Autoren einsperrt, bekämpft nicht die Kunst, sondern die Freiheit. Mahmoudian muss freigelassen werden, denn Kunst ist kein Verbrechen!
Nach übereinstimmenden Berichten wurde Mahmoudian am vergangenen Wochenende festgenommen. Konkrete Vorwürfe sind bislang nicht bekannt. Kurz zuvor hatte er gemeinsam mit weiteren Aktivistinnen und Aktivisten eine Erklärung unterzeichnet, in der das gewaltsame Vorgehen des iranischen Regimes gegen Demonstrierende sowie die politische Verantwortung der Führung scharf kritisiert wurden. Auch andere Unterzeichner wurden festgenommen.
Weimer betonte weiter: „Autoritäre Regime fürchten kulturelle Öffentlichkeit, weil sie Wirklichkeit sichtbar macht. Genau deshalb reagieren sie auf internationale Aufmerksamkeit mit Repression. Diese Logik dürfen wir nicht hinnehmen.“
Vor diesem Hintergrund hob der Staatsminister ausdrücklich die Rolle unabhängiger Medien hervor, insbesondere der Deutschen Welle, die trotz massiver Zensur- und Einschüchterungsversuche weiterhin umfassend über die Lage im Iran berichtet. Das persischsprachige Angebot der DW ermögliche Millionen Menschen Zugang zu unabhängigen Informationen, kulturellen Debatten und internationaler Öffentlichkeit.
„Wo Regime abschotten, schafft journalistische Arbeit Verbindung nach außen“, so Weimer. „Die Deutsche Welle ist in solchen Situationen mehr als ein Medium, sie ist ein Schutzraum für Freiheit. Dass das iranische Regime sie zensiert, bestätigt ihre Bedeutung.“
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien setzt sich seit Jahren für den Schutz verfolgter Kultur- und Medienschaffender ein und unterstützt Programme zur internationalen kulturellen Zusammenarbeit, zur Stärkung unabhängiger Medien sowie zur Verteidigung der Kunstfreiheit. Die Bundesregierung verfolgt die Entwicklungen im Iran aufmerksam und steht hierzu im engen Austausch mit internationalen Partnern.
Europa
Abgeordnetenversammlung für europäische Verteidigungsunion
Berlin 04.02.2026
– Der Beschluss der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung vom Dezember 2025 zu gemeinsamen Rüstungsprojekten liegt nun als Unterrichtung (21/3862) der Bundestagspräsidentin vor.
Die Abgeordneten des Deutschen Bundestags und der Assemblée nationale haben sich bei ihrem Treffen Ende vergangenen Jahres neben der Stärkung des europäischen Pfeilers in der NATO auch für einen „eigenen, aber komplementären Aufbau europäischer Fähigkeiten“ ausgesprochen. Um eine substanzielle Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Europäischen Union und damit der gemeinsamen Sicherheit zu schaffen, fordern die Parlamentarier eine europäische Verteidigungsunion. Dafür seien der Aufbau eines „echten europäischen Binnenmarkts“ für Verteidigung mit einer innovativen Verteidigungsindustrie, integrierte europäische Fähigkeiten sowie zielgerichtete Investitionen und eine intelligente Regulierung notwendig, heißt es in dem Beschluss mit der Überschrift: „Gemeinsame Rüstungsprojekte zum Erfolg führen – Europas Verteidigung stärken
Politik
DFPV will Vertiefung der deutsch-französischen Beziehungen
Berlin 04.2.2026
– Die Mitglieder der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung (DFPV) fordern die Regierungen der Bundesrepublik und Frankreichs im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auf, ihre Zusammenarbeit in Bereichen wie Bildung, Kultur und EU-Binnenmarkt zu vertiefen. Dazu haben sie in ihrer Sitzung am 1. Dezember 2025 eine Entschließung verabschiedet, zu der die Präsidentin des Deutschen Bundestages eine Unterrichtung (21/3863) vorgelegt hat.
Unter anderem sollen die Regierungen zusammen mit den Bundesländern die Umsetzung der gemeinsamen Strategie zur Förderung der Partnersprache weiter vorantreiben. Außerdem sollen sie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und gemeinsame kulturelle Initiativen stärker fördern und sich gemeinsam für die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes einsetzen.
Deutschland und Frankreich müssten ihre Rolle als Motor der europäischen Integration wahrnehmen, „um dringend benötigte gemeinsame Impulse zur Weiterentwicklung der Europäischen Union zu geben“, mahnen die Abgeordneten. Nur auf der Basis einer engen deutsch-französischen Zusammenarbeit könne Europa die gewaltigen Herausforderungen unserer Zeit meistern und gestärkt aus ihnen hervorgehen, sind sie überzeugt.
Gemäß Artikel 7 Absatz 2 des Deutsch-Französischen Parlamentsabkommens befassen sich der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale im Rahmen ihrer jeweiligen Verfahren durch ihre Organe zeitnah mit den von der Versammlung gefassten Beschlüssen.
Politik
Bundeskanzler Merz reist in die Golfstaaten
Berlin 04.02.2026
Regierungssprecher Stefan Kornelius gab bekannt, dass Bundeskanzler Friedrich Merz am 4. Februar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar besuchen wird. Der Besuch dauert bis Freitag, den 6. Februar. Während seines Besuchs wird er Gespräche mit regionalen Führungskräften über die deutsch-golfischen Beziehungen, die Lage in Gaza, Syrien, Iran und weitere Themen führen.
Kornelius gab zudem bekannt, dass Merz im Laufe dieses Monats auch Peking besuchen wird.
Politik
Pressestimmen zum Iran und der US-Regierung
Berlin 04.02.2026
– Zweifellos hat die Regierung der Mullahs in Teheran durch ihre Politik der religiösen Intoleranz maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Menschen vom Islam abwenden. Diese Politik steht in keinem Zusammenhang mit den wahren Lehren des Islam, die die Einschränkung der menschlichen Freiheit verbieten. Allerdings ist keine Religion völlig frei von Intoleranz; auch unter Christen und Juden gibt es Intoleranz, die zu Unkenntnis religiöser Lehren führt.
Niemand vergisst – insbesondere diejenigen mit gutem Gedächtnis –, dass der Anführer der Khomeini-Revolution unter amerikanischem Schutz in einem französischen Flugzeug, das ihn von Paris brachte, nach Teheran zurückkehrte. Der Konflikt zwischen Teheran und Washington beruht nicht auf Washingtons Sorge um die menschliche Freiheit im Iran, sondern vielmehr auf der Annahme, dass Teheran aufgrund seiner fortgesetzten Urananreicherung eine Bedrohung für Israel darstellt, da Israel über Atomwaffen verfügt.
Ein Angriff auf Teheran liegt nicht im Interesse Washingtons, und selbst wenn es dazu käme, würde dies nicht bedeuten, dass Washington einen Regimewechsel im Iran anstrebt. Vielmehr würde es das gegenwärtige System beibehalten.
Die STUTTGARTER ZEITUNG schreibt: „Trump hat eine große Streitmacht in Nahost zusammengezogen, um Teheran unter Druck zu setzen – und sich damit selbst unter Druck gesetzt. Das weiß auch die iranische Führung. Er lasse sich von den Kriegsschiffen nicht beeindrucken, sagt Regimechef Ali Chamenei – und droht, mit iranischen Raketen die ganze Region in Brand zu setzen. Das Pokerspiel von Trump und Chamenei ist brandgefährlich. Ein Missverständnis oder ein versehentlich abgefeuerter Schuss könnten zur Katastrophe führen“, warnt die STUTTGARTER ZEITUNG.
Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG analysiert: „Das Teheraner Regime hat keine guten Optionen. Iran ist zwar kein Venezuela, dessen Staatschef sich die Amerikaner relativ einfach schnappen konnten. Dennoch kann der Oberste Führer Chamenei nach den blutig niedergeschlagenen Massenprotesten in seinem Land die von Trump entsandte ‚Armada‘ und dessen Regimewechsel-Drohungen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das lange Engagement im fernen Ausland allerdings ist Trumps Sache nicht, weshalb auch seine Optionen begrenzt sind. Mit ein paar Kommandosoldaten und Marschflugkörpern ist die iranische Gefahr für Israel, die Region und die Welt kaum zu beseitigen“, bemerkt die F.A.Z.
Die VOLKSSTIMME aus Magdeburg hat wenig Hoffnung auf ein Ende des Teheraner Regimes: „Auch bei der letzten großen Volksaufwallung, der Protestwelle gegen die Kopftuchpflicht für Frauen 2022/23, war in der iranischen Diaspora von einem Regimeende binnen Tagen die Rede. Nichts da, die Führung zog die Zügel wieder fest an. Die gefürchteten Revolutionsgarden sind zwar nun auch von der EU mit Terror-Bann belegt worden. Doch würde sich nur etwas ändern, wenn die Truppe die Waffen von sich aus streckt. Solange das nicht passiert, sind Verhandlungen das einzige, was noch Schlimmeres im Iran verhindern kann“, glaubt die VOLKSSTIMME.
Politik
Die Vereinigten Staaten, Europa und die Welt
Berlin 04.02.2026
– Maurizio Ferraris prophezeit das Verschwinden Europas, wie wir es kennen, bis 2029
In einem Meinungsbeitrag in der spanischen Zeitung El País warnt der italienische Schriftsteller und Philosoph Maurizio Ferraris, Europa stehe vor einer entscheidenden Wahl: Entweder eine starke Verteidigung und eine geeinte, unabhängige Regierung aufbauen oder erneut unter das Joch absoluter Abhängigkeit von den beiden Supermächten Washington und Moskau geraten. Er verweist auf die Aushöhlung der politischen und souveränen Einheit des alten Kontinents inmitten des eskalierenden Konflikts zwischen den Großmächten.
Ferraris beginnt seinen Artikel mit einer düsteren Prophezeiung: Innerhalb von drei Jahren werde Europa aufhören zu existieren, nachdem es seine Energien in Warnungen und bürokratische Gesetze investiert habe. Er merkt an, dass die Gesetze der Menschheitsgeschichte die Unvermeidbarkeit dieses Szenarios bestätigen.
Der Autor erinnert an die Lehren der Geschichte und verweist auf das Jahr 1812, als Talleyrand Napoleons Motive für den Einmarsch in Russland infrage stellte. Diese Entscheidung zerstörte ein jahrhundertealtes Machtgleichgewicht und führte schließlich 1814 zur Ankunft Zar Alexanders im Herzen von Paris. Seitdem, so Ferraris, sei Russland stets bereit gewesen, nach Paris oder Berlin zurückzukehren – ein Ziel, das es 1945 mit der Eroberung der Hälfte des Kontinents erreichte.
Die „Täuschung“ der Selbstbestimmung
Der Autor zeichnet den Eintritt der Vereinigten Staaten in die internationale Bühne im Jahr 1917 nach, wo es ihnen mit minimalen menschlichen Verlusten und durch die Prinzipien des damaligen Präsidenten Woodrow Wilson bezüglich der „Selbstbestimmung der Nationen“ gelang, die multiethnische europäische Einheit zu zerschlagen. Ironischerweise nutzte Adolf Hitler später genau dieses Prinzip (das Selbstbestimmungsrecht), um die Besetzung des Sudetenlandes und den Anschluss Österreichs zu rechtfertigen.
Ferraris beschreibt die Vereinigten Staaten jener Zeit als junge, ehrgeizige Macht, ein Spiegelbild der alternden russischen Macht mit ihrer beeindruckenden strategischen Tiefe. Die amerikanische Intervention im Ersten Weltkrieg bewahrte die Westmächte nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie, der Türkei und Italiens vor der sicheren Niederlage gegen die Deutschen.
Der Autor wendet sich dann dem Zweiten Weltkrieg zu und erläutert, wie der britische Premierminister Winston Churchill mit verzweifeltem Realismus einen Plan zur Aufteilung Europas in zwei Einflusssphären entwarf, in der Hoffnung, die Amerikaner würden Berlin vor den Sowjets erreichen. Dies geschah jedoch nicht, da Washington Verluste vermeiden wollte und nach dem Tod von Präsident Franklin Roosevelt, der seit der Konferenz von Jalta stark geschwächt war, eine effektive Führung fehlte.
Ferraris stellt den europäischen Führern eine rhetorische Frage: „Glauben Sie, die Menschheit ist gut geworden?“ Er behauptet, die Realität stütze diese Annahme nicht. Die Vereinten Nationen hätten ihre „kindischen“ Ziele nicht erreicht, und die NATO sei nach wie vor ein Instrument zum Schutz amerikanischer, nicht europäischer Interessen, genau wie der Warschauer Pakt ein Instrument Moskaus gewesen sei. Der Autor warnt, der aktuelle Konflikt zwischen Washington und Moskau werde Europa, wie schon 1945, der Willkür zweier Mächte ausliefern.
Konflikt und Erwartung
Der Autor warnt, der aktuelle Konflikt zwischen Washington und Moskau – vor dem Hintergrund Chinas Bestrebungen, die Kontrolle über Taiwan zurückzuerlangen – werde Europa, wie schon 1945, der Willkür zweier Mächte ausliefern.
Ferraris geht noch weiter und beschreibt das gegenwärtige amerikanische System als ebenso „autoritär“ wie sein russisches Pendant, wobei er Donald Trumps Drohungen, seine Gegner zu bestrafen, als Beispiel anführt.
Angesichts dieser Krise kritisiert Ferraris die seiner Ansicht nach „schwachsinnigen Appelle und kraftlosen Drohungen“ sowie die ineffektive Sanktionspolitik. Er argumentiert, Europa sei heute nichts weiter als ein „geografischer Begriff“ oder ein „verstreutes Volk ohne Identität“.
Eine radikale Lösung
Aus dieser Perspektive schlägt der Autor eine radikale Lösung auf zwei Wegen vor: Der erste ist politisch und militärisch und fordert die Aufstellung einer einheitlichen europäischen Armee unter dem Kommando einer echten Regierung mit einer Führungspersönlichkeit mit weitreichenden Kriegsbefugnissen. Der zweite Weg ist finanzieller Natur und beinhaltet die Investition von „digitalem Kapital“ und den riesigen Datenmengen, die von Internetnutzern auf dem gesamten Kontinent generiert werden – eine strategische Ressource, die Europa derzeit der Ausbeutung durch große digitale Imperien aussetzt.
Der Autor schließt seinen Artikel mit einer eindringlichen Warnung an den Kontinent, den er als „Kontinent der Alten und Trägen“ bezeichnet. Er betont, dass der Besitz von Abschreckungsmacht durch Technologie und digitale Finanzen der einzige Weg sei, Souveränität zu erlangen und nicht in einen „Frieden des Friedhofs“ oder eine getarnte Sklaverei zu verfallen. Er betont, dass die Härte seiner Worte lediglich ein Spiegelbild einer noch härteren Realität sei.
Berlin
Kinder: Opfer der Gier

Berlin 30.01.2026
– Die Bundesministerin für Entwicklung und Internationale Zusammenarbeit, Reem Al-Abbali Radovan, und Vertreter von UNICEF eröffneten eine Fotoausstellung, die das Leid von Kindern in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Gaza und Afghanistan dokumentiert. Die Bilder verdeutlichen die Notlage von Kindern unter der Herrschaft ihrer Regierungen, die Gewalt ausüben, Menschenrechte verletzen und ungerechte Politik betreiben, wie beispielsweise das Schulverbot für Mädchen durch die Taliban.
Die Ministerin betonte, dass sich die Bundesregierung dem Schutz von Kindern verpflichtet fühlt und im ständigen Dialog mit internationalen Organisationen steht, um moralische und politische Unterstützung zu gewinnen und der Tragödie dieser Kinder ein Ende zu setzen, die Opfer staatlicher Gewalt sind, welche Menschenrechte verletzt und zu Hunger, Armut und Krankheit führt.
Die Ausstellung ist noch bis Ende April im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu sehen.
Politik
Cyber- und Sicherheitspakt: Deutschland und Israel proben den Ernstfall
Berlin 30.01.2026
– Premiere im Cyberraum: Deutschland und Israel haben erstmals gemeinsam die Abwehr eines schweren Cyberangriffs trainiert. Die Übung lief unter dem Namen BLUE HORIZON. Sie war der erste konkrete Schritt aus dem Cyber- und Sicherheitspakt, den Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Januar vereinbart haben.
Kern der Zusammenarbeit: der Aufbau eines deutschen Cyberdomes, angelehnt an das bewährte israelische Modell.
Bei der Übung arbeiteten Expertinnen und Experten der israelischen Nationalen Cyberdirektion Seite an Seite mit deutschen Cyber-Profis aus verschiedenen Behörden und Organisationen. Ziel: sich besser kennenlernen, Abläufe angleichen und eine gemeinsame Sprache für den Ernstfall entwickeln. Kurz gesagt: schneller reagieren, besser zusammenarbeiten, Angriffe früher stoppen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt:
„Mit der ersten gemeinsamen Cyber-Abwehrübung machen wir das Cybersicherheitspaket praktisch wirksam. Wir stärken unsere Fähigkeit, schwere Cyberangriffe abzuwehren. Diese Kooperation schafft echte Krisenkompetenz. Deutschland und Israel stehen Seite an Seite für starke, sichere Abwehrsysteme und den Aufbau eines deutschen Cyberdomes.“
Politik
Deutsch-ukrainische Gespräch
Berlin 30.01.2026
– Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Abend mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.
Der Bundeskanzler verurteilte die fortdauernde systematische und brutale Zerstörung ziviler ukrainischer Energieinfrastruktur durch russische Angriffe auf das Schärfste.
Präsident Selenskyj dankte für das Winterhilfe-Paket der Bundesregierung. Dieses umfasst neben weiterer Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung beispielsweise auch Blockheizkraftwerke und Generatoren. Es hilft der ukrainischen Zivilbevölkerung, die brutalen russischen Attacken zu überstehen.
Beide begrüßten die Bemühungen um eine Feuerpause. Der Bundeskanzler erneuerte die deutsche Unterstützung für einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine. Beide stehen hierzu in engstem Kontakt.
Politik
Exportkontrolle von Rüstungs- und Dual use-Gütern
Berlin 30.01.2026
Maßnahmenpaket zur Beschleunigung und Vereinfachung tritt zum 1. Februar in Kraft
Genehmigungsverfahren für Rüstungsgüter und Dual use Güter werden beschleunigt – Erleichterungen u.a. für europäische Rüstungskooperationen und Cloud-Nutzung zum Technologieaustausch vorgesehen. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) setzt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) zum 1. Februar 2026 verschiedene Maßnahmen in Kraft, die die Exportkontrolle von Rüstungs- und Dual use-Gütern vereinfachen und beschleunigen.
Dr. Thomas Steffen, Staatssekretär im BMWE: „Mit dem Maßnahmenbündel passen wir die Exportkontrolle an die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen an, indem wir vor allem europäische Kooperationen stärken. Zugleich schaffen wir durch neue Genehmigungsformen und gestraffte Verfahren mehr Verlässlichkeit für die Ausführer. Auf diese Weise bauen wir Bürokratie ab, konzentrieren Ressourcen und schaffen Erleichterungen für Unternehmen, wo immer dies unter Einhaltung hoher Prüfstandards möglich ist. Hierbei wird das BAFA weiterhin risikoorientiert vorgehen und die beteiligten Bundesressorts angemessen einbeziehen.“
Als Teil des Maßnahmenbündels werden weitere Allgemeine Genehmigungen (AGGs) eingeführt und bestehende AGGs aktualisiert. AGGs sind pauschale Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter und Dual use-Güter, die von Exporteuren in Anspruch genommen werden können, ohne beim BAFA einen Ausfuhrantrag stellen zu müssen. Sie gelten für den unkritischen, gleichwohl genehmigungspflichtigen Export ausgewählter Güter in ausgewählte Länder. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Kontrollressourcen auf die Exporte zu konzentrieren, die einer vertieften Bewertung bedürfen.
Als weiteres wesentliches Element werden die Entscheidungsbefugnisse des BAFA gestärkt, um die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu verkürzen. Insbesondere über den Austausch von Technologie kann so künftig schneller entschieden werden, wenn er innereuropäisch oder konzernintern erfolgt. Einen weiteren Schwerpunkt stellen Verfahrenserleichterungen für Gemeinschaftsprojekte dar. So soll mit einem neuen Verfahren der bürokratische Aufwand für nationale Teilnehmer an amtlich anerkannten Gemeinschaftsprojekten erheblich verringert werden. Hierzu wird das Instrument der „Sondergenehmigung“ geschaffen.
Im Detail zu Änderungen der AGGs:
Es wird eine neue AGG für Anträge auf die Verbringung und Ausfuhr von Technologie und Software im Rahmen des Europäischen Verteidigungsfonds eingeführt. Auch der Upload bzw. die Datenspeicherung auf näher definierten Servern in europäischen Staaten wird geregelt und erleichtert. Die AGG Nr. 21 wird dahingehend erweitert, dass sie stärker für Schutzausrüstung nutzbar ist. Mit dem Beitritt des Vereinigten Königreich zum Übereinkommen über Ausfuhrkontrollen im Rüstungsbereich wird die korrespondierende AGG Nr. 28 auch für entsprechende Ausfuhren in das Vereinigte Königreich nutzbar. Vorübergehende Ausfuhren und Verbringungen (AGG Nr. 24) sind künftig in zusätzliche Länder möglich. Für eine zeitnahe Umsetzung der Regimeentscheidung des Wassenaar Plenary vom 5.12.25 zur Entlistung bestimmter Laser vom Anhang I EU-Dual-Use-Verordnung und einer damit verbundenen möglichen Verfahrenserleichterung wird bis zum Inkrafttreten des überarbeiteten Anhangs I der Verordnung in 2026 der Güterkreis der AGG Nr. 17 um diese Laser erweitert.
-

 Politik7 Tagen ago
Politik7 Tagen agoDeutsch-Romänische Gespräch
-
Politik6 Tagen ago
Deutsch-ukrainische Gespräch
-

 Berlin6 Tagen ago
Berlin6 Tagen agoKinder: Opfer der Gier
-
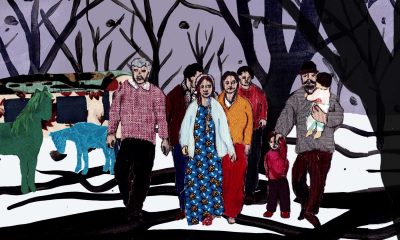
 Kunst20 Stunden ago
Kunst20 Stunden agoAICA Deutschland zeichnet Kunstmuseum Wolfsburg aus
-
Politik6 Tagen ago
Cyber- und Sicherheitspakt: Deutschland und Israel proben den Ernstfall
-
Wirtschaft6 Tagen ago
ifo Institut: Familienunternehmen in Europa erwarten ein besseres Wirtschaftsjahr 2026
-
Politik6 Tagen ago
Exportkontrolle von Rüstungs- und Dual use-Gütern
-
Wirtschaft22 Stunden ago
ifo Institut: Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie setzt Abwärtstrend fort
-

 Berlin20 Stunden ago
Berlin20 Stunden agoWenn Gesundheit zur Reise-Motivation wird
-
Politik6 Tagen ago
Arbeitsmarkt weiter unter Druck
-
Politik22 Stunden ago
Pressestimmen zum Iran und der US-Regierung
-
Politik22 Stunden ago
Bundeskanzler Merz reist in die Golfstaaten
-
Politik22 Stunden ago
Angriffe gegen Kunst durch die Mullahs Regime
-
Politik22 Stunden ago
Die Vereinigten Staaten, Europa und die Welt
-
Politik22 Stunden ago
DFPV will Vertiefung der deutsch-französischen Beziehungen