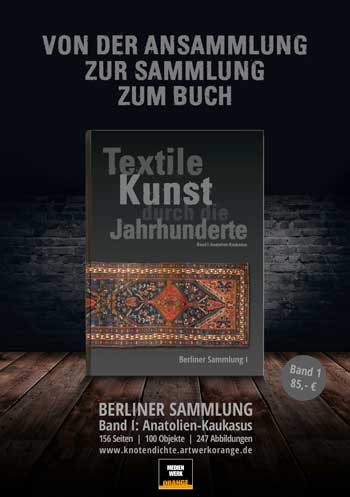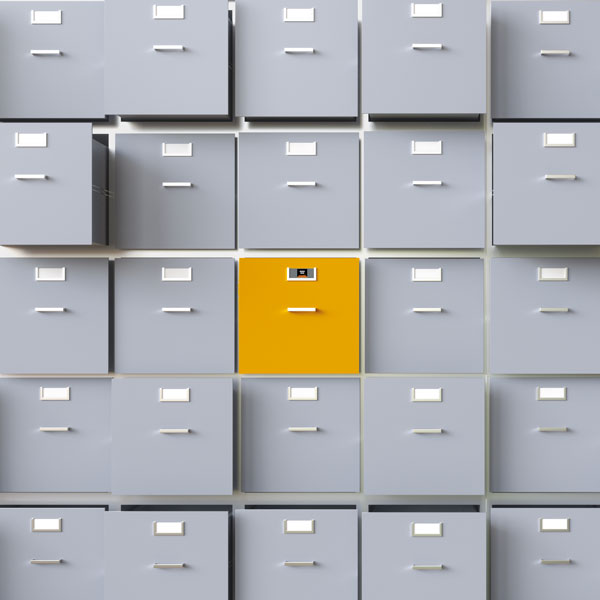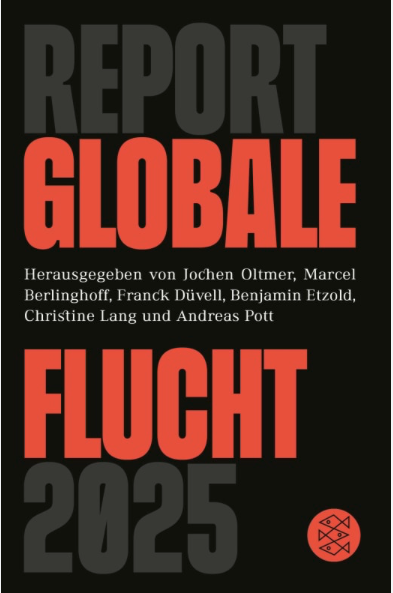Welt
Treffen der G7-Entwicklungsminister*innen: Faire Partnerschaften in der multipolaren Welt
Auf Einladung der italienischen Präsidentschaft treffen sich die G7-Entwicklungsminister*innen mit zahlreichen Gastländern in Pescara (Italien, 22.-24. Oktober). In einer gemeinsamen Erklärung bringen die G7-Partner zentrale entwicklungspolitische Initiativen voran, unter anderem im Bereich der Ernährungssicherheit sowie nachhaltiger Infrastrukturinvestitionen.
Entwicklungsministerin Svenja Schulze: „Mit der Einladung zu einem Treffen der G7-Entwicklungsminister setzt die italienische G7-Präsidentschaft ein wichtiges Zeichen: Entwicklungspolitik gehört zum Herzstück der G7-Arbeit – und ist wichtiger denn je. In der multipolaren Weltordnung steht die G7 im weltweiten Wettbewerb um internationale Partnerschaften. Mit der gemeinsamen Erklärung zeigen wir, dass wir als G7 unseren Partnerländern konkrete und faire Entwicklungspolitische Angebote machen. Dass zahlreiche BRICS-Staaten und auch viele weitere Gastländer am G7-Treffen teilnehmen, zeigt, wie groß das Interesse an der Zusammenarbeit ist.“
Das letzte Treffen der G7-Entwicklungsminister*innen fand im Jahr 2022 auf Einladung der deutschen G7-Präsidentschaft in Berlin statt. Der diesjährige Vorsitz Italien hat die Zusammenarbeit der G7 in der Entwicklungszusammenarbeit durch die Ausrichtung eines eigenständigen Treffens weiter gestärkt. An dem Austausch in Pescara nehmen neben den G7-Staaten auch der diesjährige G20-Vorsitz Brasilien sowie Kenia, Senegal, Südafrika, Uganda und Norwegen teil, außerdem mit Äthiopien und den Vereinigten Arabischen Emiraten auch zwei der neuen BRICS-Mitglieder sowie zahlreiche internationale Organisationen. Das Treffen fügt sich ein in eine Reihe wichtiger internationaler Konferenzen: So folgt es auf den Zukunftsgipfel der Vereinten Nationen Ende September und die Hamburg Sustainability Conference Anfang Oktober und findet zeitgleich zum BRICS-Gipfel im russischen Kasan, parallel zur Weltnaturkonferenz in Cali/Kolumbien, sowie vor dem G20-Gipfel Rio/Brasilien und der Weltklimakonferenz in Aserbaidschan im November statt.
In der Erklärung einigen sich die G7-Minister*innen auf die Konkretisierung und Weiterentwicklung der auf dem G7-Gipfel der Staats- und Regierungschef*innen im Juni 2024 gestarteten „Apulia Initiative für Ernährungssysteme“ (Apulia Food Systems Initiative). Sie soll weltweit strukturelle Hindernisse im Bereich der Ernährungssicherheit beseitigen und die Nachhaltigkeit und Produktivität von Landwirtschafts- und Ernährungssystemen erhöhen. Die Initiative ist in enger Abstimmung mit der “Globalen Allianz gegen Hunger und Armut“ entstanden, die die brasilianische Präsidentschaft beim G20-Gipfel am 18./19. November offiziell ins Leben rufen will. Deutschland ist der Allianz bereits kürzlich als eines der ersten Mitglieder auf der Hamburg Sustainability Conference (HSC) beigetreten. Die Ergebnisse der HSC werden in der G7-Erklärung als wichtige Schritte hin zur Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele gewürdigt.
Außerdem stärken die G7-Entwicklungsminister*innen die im Jahr 2022 unter deutscher G7-Präsidentschaft in Elmau gegründete „G7 Partnerschaft für globale Infrastruktur und Investitionen“ (PGII), die weltweit große Infrastrukturprojekte mit hohen Nachhaltigkeits- und Qualitätsansprüchen voranbringt. Durch die Einrichtung eines eigenen Sekretariats, das bei Koordination, Projektumsetzung, Kommunikation und Rechenschaftslegung unterstützt, wird die Partnerschaft weiter gefestigt. Außerdem wird eine Plattform zur besseren Datenverfügbarkeit für Infrastrukturinvestitionen in Afrika eingerichtet sowie eine Übersicht an Leuchtturmprojekten veröffentlicht.
In einer Sondersitzung am gestrigen Dienstag beschäftigten sich die G7-Staaten zudem mit dem anhaltenden Konflikt im Nahen Osten und sprachen sich für Deeskalation und humanitäre Unterstützung aus.
Berlin
Wenn Gesundheit zur Reise-Motivation wird

Berlin 04.02.2026
Der Medical & Health Tourism Pavilion in Halle 4.1 wächst und bündelt auf der ITB Berlin vom 3. bis 5. März 2026 internationale Aussteller, europäische Partner sowie erstmals die Charité, Universitätsmedizin Berlin, und bietet neue Formate rund um medizinische Versorgung, Prävention und Longevity. Networking, Bühnenprogramm und erstmals zwei Awards runden das Angebot ab.
Medical & Health Tourism ist längst mehr als ein Trend. Auf der ITB Berlin 2026 wird deutlich, wie geplante Behandlungen im Ausland, spezialisierte Kliniken, hochwertige Präventionsangebote und ganzheitliche Regeneration weltweit wachsen. Die Kombination aus medizinischer Kompetenz, evidenzbasierten Health-Angeboten und touristischer Infrastruktur macht das Segment für Destinationen, Kliniken und Reiseanbieter gleichermaßen attraktiv.
Neue Aussteller und internationale Vielfalt in Halle 4.1
Der Pavilion bleibt ein zentraler Treffpunkt für Gesundheitspartner, Kliniken, Destinationen, Verbände und die Reiseindustrie in Halle 4.1, mit dem Ziel, Qualität, Vertrauen und messbaren Mehrwert für Reisende und Patient:innen sichtbar zu machen. Für 2026 wächst der Medical & Health Tourism Pavilion in Halle 4.1 weiter und begrüßt zahlreiche neue wie etablierte Partner: Crescent Meditours bringt ein Netzwerk aus 20 Kliniken aus Indien nach Berlin, Astana Tourism ist mit vier Kliniken aus Kasachstan vertreten und zugleich Supporting Partner des Pavilion, und Health Croatia ist bereits im dritten Jahr dabei, vergrößert erneut die Fläche und reist mit zwölf Gesundheitspartnern aus Kroatien an.
Erstmals ist zudem Bulgarien mit einem eigenen Stand im Pavilion präsent und ebenfalls Supporting Partner des Medical Pavilion. Neu dabei ist außerdem die Health Tourism Association aus Saudi-Arabien. Wieder mit an Bord sind die Gremi Klinik aus Albanien sowie das Bangkok Hospital aus Thailand, ein starkes Zeichen für die wachsende internationale Relevanz des Segments.
Starke Partner: Thermal Health, Longevity und europäische Gesundheitskompetenz
Mit neuen und bewährten Partnern rückt die ITB Berlin 2026 die Schnittstelle zwischen Tourismus und evidenzbasierter Gesundheitsförderung noch stärker in den Fokus. Erstmals im dem Pavilion präsentiert die European Historic Thermal Towns Association (EHTTA), langjähriger Organizational Partner und Aussteller der ITB Berlin, gleich drei neue Thermal-Destinationen: Spa (Belgien), Baden (Schweiz)und Viterbo (Italien).
Die ESPA – European Spas Association ist langjähriger Aussteller und Organizational Partner der ITB Berlin. Sie rückt zentrale Zukunftsthemen in den Fokus und beleuchtet dabei die wissenschaftlichen Hintergründe aktueller Branchentrends und Buzzwords. Geplant sind Panel-Formate wie „Longevity, Regeneration & Prevention: Beyond the Buzzwords“, in dem es um die medizinisch validierte Rolle von Thermalmedizin als Prävention, natürliche Heilmittel und Klimatherapie sowie Evidenz aus europäischen Spas geht.
Darüber hinaus beleuchtet die Session „Nature-Based Health: From Trend to Treatment“ den Wandel naturbasierter Gesundheitsangebote hin zu ernstzunehmenden Therapieansätzen. Dazu zählen Green Care und Forest Therapy, bei denen Natur gezielt zur Förderung von körperlicher und mentaler Gesundheit eingesetzt wird und deren Wirksamkeit wissenschaftlich durch Studien zum Naturkontakt belegt ist. Ergänzt werden diese Ansätze durch etablierte Therapieformen wie Thalasso, Klimatherapie und Balneologie. Alternativ ist auch ein Format wie „Digital Health Meets Thermal Health“ vorgesehen, das die Verbindung moderner digitaler Gesundheitslösungen mit klassischen Health-Angeboten diskutiert. Mit eigenem Stand vertreten ist erneut der Partner HTI – Health Tourism Industry. Neu hinzugekommen ist die EHMTA – European Health & Medical Tourism Association, die die internationale Vernetzung des Segments weiter stärkt.
Charité erstmals als Partner im Bühnenprogramm
Ein besonderes Highlight 2026: Erstmals ist die Charité, Universitätsmedizin BerlinPartner des Bühnenprogramms im Medical & Health Tourism Pavilion. Sie wird eine Präsentation halten und zudem an einem Panel teilnehmen, das ihr Engagement in Saudi-Arabien beleuchtet, einem neuen Aussteller im Pavilion. Für die ITB Berlin ist diese Partnerschaft ein wichtiger Schritt, um gezielt Medical Buyer anzusprechen, die im Bereich Patientenvermittlung tätig sind und nach belastbaren, vertrauenswürdigen Netzwerken suchen.
Awards 2026: Erstmals zwei Auszeichnungen für Medical & Health Tourism
Ein weiteres Signal für die wachsende Bedeutung des Segments: 2026 werden erstmals zwei Awards vergeben, statt wie bisher nur einem Preis. Die Auszeichnungen werden von einer internationalen Jury nach festen Kriterien vergeben. Der ITB Medical Tourism Award 2026 geht an Visit Düsseldorf, der ITB Health Tourism Award 2026 an Italien.
Foto: © ITB Berlin
Politik
Bemühungen zur Reintegration von Transnistrien
Berlin 03.02.2026
– Die OSZE-Mission in Moldau umfasst 52 Mitarbeiter, darunter 39 lokale Missionsmitarbeiter und 13 internationale Vertreter. Die Ausgaben für die Mission beliefen sich 2025 auf rund 2,3 Millionen Euro, wie aus der Antwort (21/3820) der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage (21/3424) der Linksfraktion hervorgeht.
Seit Beginn der Mission 1993 habe nahezu durchgehend mindestens ein deutscher Mitarbeiter für sie gearbeitet. Seit 2024 sei eine Deutsche stellvertretende (und seit Sommer 2025 amtierende) Missionsleiterin, heißt es in der Antwort weiter.
Die Bundesregierung unterstützt den Angaben zufolge die Bemühungen der moldauischen Regierung zur Reintegration des abtrünnigen Teils des Staatsgebietes, Transnistrien. Deutschland sei dazu gemeinsam mit anderen Partnern in verschiedenen Dialogforen aktiv.
Zudem unterstütze die Bundesregierung die Bemühungen der internationalen Gemeinschaft durch die Entsendung von Mitarbeitern in verschiedene internationale Missionen in Moldau. So sei ein Außenamtsmitarbeiter als Sonderbeauftragter des amtierenden OSZE-Vorsitzes für die Beilegung der Transnistrien-Frage tätig.
Die OSZE-Mission in Moldau sei mandatiert, auf dem gesamten Gebiet der Republik Moldau tätig zu sein. Unabhängig davon versuche die transnistrische Seite, den Zugang teilweise zu kontrollieren oder einzuschränken. Die Bundesregierung setze sich nachdrücklich für die uneingeschränkte Ausübung des Mandats der OSZE-Mission in der Republik Moldau ein.
Politik
Straße von Hormus
Berlin 04.02.2026
– Was würde geschehen, wenn der Iran die Straße von Hormus sperren würde?
Angesichts der eskalierenden militärischen Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran rückt die Straße von Hormus wieder in den Vordergrund – als wichtiger Engpass für die globalen Energiemärkte und strategisches Druckmittel, das die Spannungen von politischer Rhetorik zu einem weitreichenden internationalen Wirtschaftsschock eskalieren lassen kann.
Diese Wasserstraße war nie nur eine Passage für Schiffe; sie war historisch mit bedeutenden Konflikten am Golf verbunden, wie ein Bericht von Suhaib Al-Asa auf Al Jazeera verdeutlicht. Er erinnert an die Jahre des Iran-Irak-Krieges, als die Straße zum offenen Schlachtfeld für Tanker wurde.
In jenen Jahren wurden Öltanker von beiden Seiten angegriffen, was zu massiven Störungen der Schifffahrt und Rekordpreisen für Öl führte. Dies festigte die Position der Straße als zentraler politischer und wirtschaftlicher Punkt, dessen Brisanz mit jeder neuen militärischen Eskalation zunahm. Die Straße von Hormus verbindet den Persischen Golf mit dem Golf von Oman und dem Arabischen Meer. Die Straße von Hormus erstreckt sich über rund 180 Kilometer, ist an ihrer schmalsten Stelle maximal 33 Kilometer breit und bis zu 60 Meter tief und ermöglicht so die Durchfahrt für die größten Öltanker.
Die Straße besteht aus zwei jeweils 3 Kilometer breiten Schifffahrtswegen, die durch eine Pufferzone getrennt sind. Ihre Hoheitsgewässer unterstehen der Hoheitsgewalt Irans und Omans. Täglich passieren rund 21 Millionen Barrel Öl die Straße, was etwa 21 % des weltweiten Ölhandels entspricht. Die Bedeutung dieser Zahlen reicht jedoch weit über Öl hinaus: Mehr als 20 % des weltweiten Handels mit Flüssigerdgas (LNG) werden ebenfalls durch die Straße transportiert. Damit ist sie eine lebenswichtige Ader für die Energiesicherheit in Asien, insbesondere für China, Indien, Japan und Südkorea, sowie für Europa. Eine vollständige Schließung der Straße von Hormus könnte die Ölpreise innerhalb weniger Tage auf 200 US-Dollar pro Barrel treiben, mit explodierenden Kosten für die Schiffsversicherung und einer gravierenden Versorgungsknappheit – ein Szenario, das die globalen Energiemärkte erschüttern würde. Militärisch gesehen gilt die freie Schifffahrt in der Straße von Hormus für die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten als rote Linie. Jede Sperrung könnte daher eine direkte militärische Intervention auslösen, obwohl der Iran selbst für seine Ölexporte und lebenswichtigen Importe auf die Straße angewiesen ist.
In den Jahren erhöhter Spannungen drohte Teheran wiederholt damit, die Straße als Druckmittel einzusetzen, wie beispielsweise 2019 mit Angriffen auf Tanker im Golf von Oman und der Beschlagnahmung von Handelsschiffen. Anschließend intensivierte der Iran seine Marinepatrouillen und drohte mit Vergeltungsmaßnahmen.
Militärischen Einschätzungen zufolge nutzt der Iran unkonventionelle Methoden, um den Schiffsverkehr zu stören. Dazu gehören Tausende von Seeminen, mit Raketen und Torpedos bestückte Schnellboote, Kamikaze-Drohnen und Störtechnologien, die globale Navigationssysteme lahmlegen. Mit diesen Mitteln verwandelt sich die Straße von Hormus von einer lebenswichtigen Energieroute in ein potenzielles Schlachtfeld, auf dem militärische Kalkulationen mit der Weltwirtschaft verwoben sind – in einer offenen Konfrontation, deren Grenzen und Ausgang schwer vorherzusagen sind.
Politik
Angriffe gegen Kunst durch die Mullahs Regime
Berlin 02.02.2026
– Die Festnahme von Mehdi Mahmoudian ist kein Einzelfall, sondern Teil eines Systems, das kritische Stimmen gezielt zum Schweigen bringen will. Wer Autorinnen und Autoren einsperrt, bekämpft nicht die Kunst, sondern die Freiheit. Mahmoudian muss freigelassen werden, denn Kunst ist kein Verbrechen!
Nach übereinstimmenden Berichten wurde Mahmoudian am vergangenen Wochenende festgenommen. Konkrete Vorwürfe sind bislang nicht bekannt. Kurz zuvor hatte er gemeinsam mit weiteren Aktivistinnen und Aktivisten eine Erklärung unterzeichnet, in der das gewaltsame Vorgehen des iranischen Regimes gegen Demonstrierende sowie die politische Verantwortung der Führung scharf kritisiert wurden. Auch andere Unterzeichner wurden festgenommen.
Weimer betonte weiter: „Autoritäre Regime fürchten kulturelle Öffentlichkeit, weil sie Wirklichkeit sichtbar macht. Genau deshalb reagieren sie auf internationale Aufmerksamkeit mit Repression. Diese Logik dürfen wir nicht hinnehmen.“
Vor diesem Hintergrund hob der Staatsminister ausdrücklich die Rolle unabhängiger Medien hervor, insbesondere der Deutschen Welle, die trotz massiver Zensur- und Einschüchterungsversuche weiterhin umfassend über die Lage im Iran berichtet. Das persischsprachige Angebot der DW ermögliche Millionen Menschen Zugang zu unabhängigen Informationen, kulturellen Debatten und internationaler Öffentlichkeit.
„Wo Regime abschotten, schafft journalistische Arbeit Verbindung nach außen“, so Weimer. „Die Deutsche Welle ist in solchen Situationen mehr als ein Medium, sie ist ein Schutzraum für Freiheit. Dass das iranische Regime sie zensiert, bestätigt ihre Bedeutung.“
Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien setzt sich seit Jahren für den Schutz verfolgter Kultur- und Medienschaffender ein und unterstützt Programme zur internationalen kulturellen Zusammenarbeit, zur Stärkung unabhängiger Medien sowie zur Verteidigung der Kunstfreiheit. Die Bundesregierung verfolgt die Entwicklungen im Iran aufmerksam und steht hierzu im engen Austausch mit internationalen Partnern.
Politik
DFPV will Vertiefung der deutsch-französischen Beziehungen
Berlin 04.2.2026
– Die Mitglieder der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung (DFPV) fordern die Regierungen der Bundesrepublik und Frankreichs im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel auf, ihre Zusammenarbeit in Bereichen wie Bildung, Kultur und EU-Binnenmarkt zu vertiefen. Dazu haben sie in ihrer Sitzung am 1. Dezember 2025 eine Entschließung verabschiedet, zu der die Präsidentin des Deutschen Bundestages eine Unterrichtung (21/3863) vorgelegt hat.
Unter anderem sollen die Regierungen zusammen mit den Bundesländern die Umsetzung der gemeinsamen Strategie zur Förderung der Partnersprache weiter vorantreiben. Außerdem sollen sie die grenzüberschreitende Zusammenarbeit und gemeinsame kulturelle Initiativen stärker fördern und sich gemeinsam für die Vollendung des Europäischen Binnenmarktes einsetzen.
Deutschland und Frankreich müssten ihre Rolle als Motor der europäischen Integration wahrnehmen, „um dringend benötigte gemeinsame Impulse zur Weiterentwicklung der Europäischen Union zu geben“, mahnen die Abgeordneten. Nur auf der Basis einer engen deutsch-französischen Zusammenarbeit könne Europa die gewaltigen Herausforderungen unserer Zeit meistern und gestärkt aus ihnen hervorgehen, sind sie überzeugt.
Gemäß Artikel 7 Absatz 2 des Deutsch-Französischen Parlamentsabkommens befassen sich der Deutsche Bundestag und die Assemblée nationale im Rahmen ihrer jeweiligen Verfahren durch ihre Organe zeitnah mit den von der Versammlung gefassten Beschlüssen.
Politik
Bundeskanzler Merz reist in die Golfstaaten
Berlin 04.02.2026
Regierungssprecher Stefan Kornelius gab bekannt, dass Bundeskanzler Friedrich Merz am 4. Februar, die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien und Katar besuchen wird. Der Besuch dauert bis Freitag, den 6. Februar. Während seines Besuchs wird er Gespräche mit regionalen Führungskräften über die deutsch-golfischen Beziehungen, die Lage in Gaza, Syrien, Iran und weitere Themen führen.
Kornelius gab zudem bekannt, dass Merz im Laufe dieses Monats auch Peking besuchen wird.
Politik
Pressestimmen zum Iran und der US-Regierung
Berlin 04.02.2026
– Zweifellos hat die Regierung der Mullahs in Teheran durch ihre Politik der religiösen Intoleranz maßgeblich dazu beigetragen, dass sich Menschen vom Islam abwenden. Diese Politik steht in keinem Zusammenhang mit den wahren Lehren des Islam, die die Einschränkung der menschlichen Freiheit verbieten. Allerdings ist keine Religion völlig frei von Intoleranz; auch unter Christen und Juden gibt es Intoleranz, die zu Unkenntnis religiöser Lehren führt.
Niemand vergisst – insbesondere diejenigen mit gutem Gedächtnis –, dass der Anführer der Khomeini-Revolution unter amerikanischem Schutz in einem französischen Flugzeug, das ihn von Paris brachte, nach Teheran zurückkehrte. Der Konflikt zwischen Teheran und Washington beruht nicht auf Washingtons Sorge um die menschliche Freiheit im Iran, sondern vielmehr auf der Annahme, dass Teheran aufgrund seiner fortgesetzten Urananreicherung eine Bedrohung für Israel darstellt, da Israel über Atomwaffen verfügt.
Ein Angriff auf Teheran liegt nicht im Interesse Washingtons, und selbst wenn es dazu käme, würde dies nicht bedeuten, dass Washington einen Regimewechsel im Iran anstrebt. Vielmehr würde es das gegenwärtige System beibehalten.
Die STUTTGARTER ZEITUNG schreibt: „Trump hat eine große Streitmacht in Nahost zusammengezogen, um Teheran unter Druck zu setzen – und sich damit selbst unter Druck gesetzt. Das weiß auch die iranische Führung. Er lasse sich von den Kriegsschiffen nicht beeindrucken, sagt Regimechef Ali Chamenei – und droht, mit iranischen Raketen die ganze Region in Brand zu setzen. Das Pokerspiel von Trump und Chamenei ist brandgefährlich. Ein Missverständnis oder ein versehentlich abgefeuerter Schuss könnten zur Katastrophe führen“, warnt die STUTTGARTER ZEITUNG.
Die FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG analysiert: „Das Teheraner Regime hat keine guten Optionen. Iran ist zwar kein Venezuela, dessen Staatschef sich die Amerikaner relativ einfach schnappen konnten. Dennoch kann der Oberste Führer Chamenei nach den blutig niedergeschlagenen Massenprotesten in seinem Land die von Trump entsandte ‚Armada‘ und dessen Regimewechsel-Drohungen nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das lange Engagement im fernen Ausland allerdings ist Trumps Sache nicht, weshalb auch seine Optionen begrenzt sind. Mit ein paar Kommandosoldaten und Marschflugkörpern ist die iranische Gefahr für Israel, die Region und die Welt kaum zu beseitigen“, bemerkt die F.A.Z.
Die VOLKSSTIMME aus Magdeburg hat wenig Hoffnung auf ein Ende des Teheraner Regimes: „Auch bei der letzten großen Volksaufwallung, der Protestwelle gegen die Kopftuchpflicht für Frauen 2022/23, war in der iranischen Diaspora von einem Regimeende binnen Tagen die Rede. Nichts da, die Führung zog die Zügel wieder fest an. Die gefürchteten Revolutionsgarden sind zwar nun auch von der EU mit Terror-Bann belegt worden. Doch würde sich nur etwas ändern, wenn die Truppe die Waffen von sich aus streckt. Solange das nicht passiert, sind Verhandlungen das einzige, was noch Schlimmeres im Iran verhindern kann“, glaubt die VOLKSSTIMME.
Welt
Absatz von Fairtrade-Kakao 2025 deutlich gestiegen
· Trotz hoher Rohstoffpreise: Fairtrade-Kakaoabsatz in Deutschland steigt 2025
· 30 Jahre Fairtrade-Kakao als Fundament für resiliente Lieferketten und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen im Kakaoanbau
Berlin 04.02.2026
Fairtrade Deutschland blickt optimistisch auf die Absatzentwicklung von fairem Kakao: Trotz hoher Rohstoffpreise und anhaltender Herausforderungen in den globalen Lieferketten prognostiziert die Organisation für 2025 einen deutlichen Anstieg des Fairtrade-Kakaoabsatzes um rund 11,7 Prozent auf 99.000 Tonnen.
Von dem Wachstum profitieren die Fairtrade-Kakaokooperativen: Rund 22 Mio. Euro Prämien-Gelder erwirtschafteten sie für ihre Kakaoverkäufe 2025, so die Prognose. Die Prämie erhalten sie zusätzlich zum Verkaufspreis. Sie fließt unter anderem in bessere Einkommen, Bildungsprojekte, Klimaanpassungsmaßnahmen und die Stärkung lokaler Strukturen.
„Wir sehen sehr klar: Verbraucher*innen greifen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiterhin zu Schokolade mit echtem Kakao – und setzen dabei zunehmend auf Produkte mit dem Fairtrade-Siegel“, sagt Claudia Brück, Vorständin bei Fairtrade Deutschland „Drei Jahrzehnte Erfahrung im Kakaomarkt machen Fairtrade zu einem stabilen Partner – gerade in Zeiten hoher Unsicherheit.“
30 Jahre Fairtrade-Kakao: Von den ersten Tafeln zum Marktstandard
2026 feiert Fairtrade Deutschland 30 Jahre Fairtrade-Kakao. 1996 kamen die ersten gesiegelten Tafeln Schokolade und Trinkschokoladen auf den deutschen Markt. Im Jahr 2024 erreichte Fairtrade-Kakao einen Marktanteil von 21 Prozent. Inzwischen bieten 185 Partner Produkte mit fair gehandeltem Kakao an.
Ein Meilenstein war die Einführung des Fairtrade-Kakao-Programms im Jahr 2014, das Partnern den Einstieg in Fairtrade-Kakao erleichtert hat und einherging mit der Einführung des Rohstoff-Siegels. Das Fairtrade-Siegel auf weißem Grund zeigt an, dass die auf dem Etikett genannte Zutat aus fairem Handel stammt. Seither können Unternehmen Fairtrade-Kakao als Einzelrohstoff beziehen und über mehrere Sortimente hinweg oder für die Gesamtproduktion verwenden. Bereits im ersten Jahr des Programms stieg der Absatz um das Zwanzigfache.
In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden über 570.000 Tonnen Fairtrade-Kakao in Deutschland abgesetzt. Die daraus resultierenden Prämienzahlungen von mehr als 130 Millionen Euro haben maßgeblich zur Stärkung der Kakaokooperativen beigetragen.
Fairtrade-Strategie zur Existenzsicherung
Die Einkommenssituation von Kakaobauern und -bäuerinnen bleibt eine massive Herausforderung. Um dieser zu begegnen und Einkommen sowie Lebensbedingungen zu verbessern, hat Fairtrade eine Strategie für existenzsichernde Einkommen ins Leben gerufen.
Diese umfasst die Berechnung eines Kakaopreises, in den essentielle Faktoren wie Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, sicheren Wohnverhältnissen, Bildung, medizinischer Versorgung sowie finanzielle Rücklagen für unerwartete Ereignisse und Altersvorsorge miteingerechnet werden.
Neben den monetären Aspekten fördert die Fairtrade-Strategie auch nachhaltige Anbaumethoden und stellt langfristige Handelspartnerschaften her, die größere Abnahmemengen ermöglichen. Fairtrade-Partner investieren in begleitende Programme, die sowohl einzelne Bäuerinnen und Bauern, als auch die Gemeinschaft der Kooperativen stärken.
Politik
Die Vereinigten Staaten, Europa und die Welt
Berlin 04.02.2026
– Maurizio Ferraris prophezeit das Verschwinden Europas, wie wir es kennen, bis 2029
In einem Meinungsbeitrag in der spanischen Zeitung El País warnt der italienische Schriftsteller und Philosoph Maurizio Ferraris, Europa stehe vor einer entscheidenden Wahl: Entweder eine starke Verteidigung und eine geeinte, unabhängige Regierung aufbauen oder erneut unter das Joch absoluter Abhängigkeit von den beiden Supermächten Washington und Moskau geraten. Er verweist auf die Aushöhlung der politischen und souveränen Einheit des alten Kontinents inmitten des eskalierenden Konflikts zwischen den Großmächten.
Ferraris beginnt seinen Artikel mit einer düsteren Prophezeiung: Innerhalb von drei Jahren werde Europa aufhören zu existieren, nachdem es seine Energien in Warnungen und bürokratische Gesetze investiert habe. Er merkt an, dass die Gesetze der Menschheitsgeschichte die Unvermeidbarkeit dieses Szenarios bestätigen.
Der Autor erinnert an die Lehren der Geschichte und verweist auf das Jahr 1812, als Talleyrand Napoleons Motive für den Einmarsch in Russland infrage stellte. Diese Entscheidung zerstörte ein jahrhundertealtes Machtgleichgewicht und führte schließlich 1814 zur Ankunft Zar Alexanders im Herzen von Paris. Seitdem, so Ferraris, sei Russland stets bereit gewesen, nach Paris oder Berlin zurückzukehren – ein Ziel, das es 1945 mit der Eroberung der Hälfte des Kontinents erreichte.
Die „Täuschung“ der Selbstbestimmung
Der Autor zeichnet den Eintritt der Vereinigten Staaten in die internationale Bühne im Jahr 1917 nach, wo es ihnen mit minimalen menschlichen Verlusten und durch die Prinzipien des damaligen Präsidenten Woodrow Wilson bezüglich der „Selbstbestimmung der Nationen“ gelang, die multiethnische europäische Einheit zu zerschlagen. Ironischerweise nutzte Adolf Hitler später genau dieses Prinzip (das Selbstbestimmungsrecht), um die Besetzung des Sudetenlandes und den Anschluss Österreichs zu rechtfertigen.
Ferraris beschreibt die Vereinigten Staaten jener Zeit als junge, ehrgeizige Macht, ein Spiegelbild der alternden russischen Macht mit ihrer beeindruckenden strategischen Tiefe. Die amerikanische Intervention im Ersten Weltkrieg bewahrte die Westmächte nach dem Zusammenbruch der österreichisch-ungarischen Monarchie, der Türkei und Italiens vor der sicheren Niederlage gegen die Deutschen.
Der Autor wendet sich dann dem Zweiten Weltkrieg zu und erläutert, wie der britische Premierminister Winston Churchill mit verzweifeltem Realismus einen Plan zur Aufteilung Europas in zwei Einflusssphären entwarf, in der Hoffnung, die Amerikaner würden Berlin vor den Sowjets erreichen. Dies geschah jedoch nicht, da Washington Verluste vermeiden wollte und nach dem Tod von Präsident Franklin Roosevelt, der seit der Konferenz von Jalta stark geschwächt war, eine effektive Führung fehlte.
Ferraris stellt den europäischen Führern eine rhetorische Frage: „Glauben Sie, die Menschheit ist gut geworden?“ Er behauptet, die Realität stütze diese Annahme nicht. Die Vereinten Nationen hätten ihre „kindischen“ Ziele nicht erreicht, und die NATO sei nach wie vor ein Instrument zum Schutz amerikanischer, nicht europäischer Interessen, genau wie der Warschauer Pakt ein Instrument Moskaus gewesen sei. Der Autor warnt, der aktuelle Konflikt zwischen Washington und Moskau werde Europa, wie schon 1945, der Willkür zweier Mächte ausliefern.
Konflikt und Erwartung
Der Autor warnt, der aktuelle Konflikt zwischen Washington und Moskau – vor dem Hintergrund Chinas Bestrebungen, die Kontrolle über Taiwan zurückzuerlangen – werde Europa, wie schon 1945, der Willkür zweier Mächte ausliefern.
Ferraris geht noch weiter und beschreibt das gegenwärtige amerikanische System als ebenso „autoritär“ wie sein russisches Pendant, wobei er Donald Trumps Drohungen, seine Gegner zu bestrafen, als Beispiel anführt.
Angesichts dieser Krise kritisiert Ferraris die seiner Ansicht nach „schwachsinnigen Appelle und kraftlosen Drohungen“ sowie die ineffektive Sanktionspolitik. Er argumentiert, Europa sei heute nichts weiter als ein „geografischer Begriff“ oder ein „verstreutes Volk ohne Identität“.
Eine radikale Lösung
Aus dieser Perspektive schlägt der Autor eine radikale Lösung auf zwei Wegen vor: Der erste ist politisch und militärisch und fordert die Aufstellung einer einheitlichen europäischen Armee unter dem Kommando einer echten Regierung mit einer Führungspersönlichkeit mit weitreichenden Kriegsbefugnissen. Der zweite Weg ist finanzieller Natur und beinhaltet die Investition von „digitalem Kapital“ und den riesigen Datenmengen, die von Internetnutzern auf dem gesamten Kontinent generiert werden – eine strategische Ressource, die Europa derzeit der Ausbeutung durch große digitale Imperien aussetzt.
Der Autor schließt seinen Artikel mit einer eindringlichen Warnung an den Kontinent, den er als „Kontinent der Alten und Trägen“ bezeichnet. Er betont, dass der Besitz von Abschreckungsmacht durch Technologie und digitale Finanzen der einzige Weg sei, Souveränität zu erlangen und nicht in einen „Frieden des Friedhofs“ oder eine getarnte Sklaverei zu verfallen. Er betont, dass die Härte seiner Worte lediglich ein Spiegelbild einer noch härteren Realität sei.
Berlin
Kinder: Opfer der Gier

Berlin 30.01.2026
– Die Bundesministerin für Entwicklung und Internationale Zusammenarbeit, Reem Al-Abbali Radovan, und Vertreter von UNICEF eröffneten eine Fotoausstellung, die das Leid von Kindern in Ländern wie der Demokratischen Republik Kongo, Gaza und Afghanistan dokumentiert. Die Bilder verdeutlichen die Notlage von Kindern unter der Herrschaft ihrer Regierungen, die Gewalt ausüben, Menschenrechte verletzen und ungerechte Politik betreiben, wie beispielsweise das Schulverbot für Mädchen durch die Taliban.
Die Ministerin betonte, dass sich die Bundesregierung dem Schutz von Kindern verpflichtet fühlt und im ständigen Dialog mit internationalen Organisationen steht, um moralische und politische Unterstützung zu gewinnen und der Tragödie dieser Kinder ein Ende zu setzen, die Opfer staatlicher Gewalt sind, welche Menschenrechte verletzt und zu Hunger, Armut und Krankheit führt.
Die Ausstellung ist noch bis Ende April im Willy-Brandt-Haus in Berlin zu sehen.
Politik
Cyber- und Sicherheitspakt: Deutschland und Israel proben den Ernstfall
Berlin 30.01.2026
– Premiere im Cyberraum: Deutschland und Israel haben erstmals gemeinsam die Abwehr eines schweren Cyberangriffs trainiert. Die Übung lief unter dem Namen BLUE HORIZON. Sie war der erste konkrete Schritt aus dem Cyber- und Sicherheitspakt, den Bundesinnenminister Alexander Dobrindt und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu im Januar vereinbart haben.
Kern der Zusammenarbeit: der Aufbau eines deutschen Cyberdomes, angelehnt an das bewährte israelische Modell.
Bei der Übung arbeiteten Expertinnen und Experten der israelischen Nationalen Cyberdirektion Seite an Seite mit deutschen Cyber-Profis aus verschiedenen Behörden und Organisationen. Ziel: sich besser kennenlernen, Abläufe angleichen und eine gemeinsame Sprache für den Ernstfall entwickeln. Kurz gesagt: schneller reagieren, besser zusammenarbeiten, Angriffe früher stoppen.
Bundesinnenminister Alexander Dobrindt:
„Mit der ersten gemeinsamen Cyber-Abwehrübung machen wir das Cybersicherheitspaket praktisch wirksam. Wir stärken unsere Fähigkeit, schwere Cyberangriffe abzuwehren. Diese Kooperation schafft echte Krisenkompetenz. Deutschland und Israel stehen Seite an Seite für starke, sichere Abwehrsysteme und den Aufbau eines deutschen Cyberdomes.“
Politik
Deutsch-ukrainische Gespräch
Berlin 30.01.2026
– Bundeskanzler Friedrich Merz hat am Abend mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj telefoniert.
Der Bundeskanzler verurteilte die fortdauernde systematische und brutale Zerstörung ziviler ukrainischer Energieinfrastruktur durch russische Angriffe auf das Schärfste.
Präsident Selenskyj dankte für das Winterhilfe-Paket der Bundesregierung. Dieses umfasst neben weiterer Unterstützung für die ukrainische Luftverteidigung beispielsweise auch Blockheizkraftwerke und Generatoren. Es hilft der ukrainischen Zivilbevölkerung, die brutalen russischen Attacken zu überstehen.
Beide begrüßten die Bemühungen um eine Feuerpause. Der Bundeskanzler erneuerte die deutsche Unterstützung für einen gerechten und dauerhaften Frieden für die Ukraine. Beide stehen hierzu in engstem Kontakt.
Politik
Deutsch-Romänische Gespräch

Berlin 29.01.2029
– Die Gespräche zwischen Bundeskanzler Friedrich Merz und seinem Gast, dem rumänischen Ministerpräsidenten Ilie Bulăuán, fanden am Mittwoch, dem 28. Januar, in Berlin statt. Im Mittelpunkt standen die Entwicklung der Sicherheitskooperation und die Stärkung der deutsch-rumänischen Wirtschaftsbeziehungen. Beide Staatschefs bekräftigten ihre Unterstützung für die Sicherheits- und Wirtschaftspolitik der Europäischen Union.
Der rumänische Ministerpräsident betonte, dass seine Regierung alle Anstrengungen unternimmt, die Korruption zu bekämpfen und im Rahmen ihrer EU-Mitgliedschaft bedeutende Fortschritte erzielt hat.
Foto: © PWO
Politik
10 humanitäre Krisen, die keine Schlagzeilen machten
Berlin 28.01.2026.
– Der CARE-Krisenreport untersucht jährlich die globale Online-Berichterstattung humanitärer Krisen. Die am 28. Januar erschienene zehnte Ausgabe des Berichts zeigt: Die Zentralafrikanische Republik führt mit nur 1.532 Online-Artikeln die Liste der im Jahr 2025 am wenigsten beachteten Krisen an.
Ein langanhaltender Konflikt führt dazu, dass in der Zentralafrikanischen Republik mehr als 2,4 Millionen Menschen in Not sind. Etwa jeder fünfte Mensch ist auf der Flucht. Zugleich verzeichnet das Land mit der diesjährigen Platzierung einen traurigen Rekord: Die Zentralafrikanische Republik ist in jeder der zehn Ausgaben des CARE-Krisenreports seit 2016 vertreten.
„Seit einem Jahrzehnt lenkt der CARE-Krisenreport den Blick auf humanitäre Notlagen, die Gefahr laufen, aus der öffentlichen Wahrnehmung zu verschwinden“, erklärte Karl-Otto Zentel, Generalsekretär von CARE Deutschland. „Doch Aufmerksamkeit ist eine Frage der Menschenwürde und des Überlebens. Denn wo Krisen unsichtbar bleiben, fehlt oft auch die finanzielle Unterstützung. Für Menschen in Krisenregionen bedeutet das unter anderem weniger Nahrung, weniger medizinische Versorgung, weniger Hoffnung.“
Acht vergessene Krisen in Afrika
Den zweiten Platz auf der Liste belegt Namibia, wo 1,3 Millionen Menschen sich nicht ausreichend ernähren können. Sambia nimmt Platz drei ein: Dort sind 5,5 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen. Während im diesjährigen CARE-Krisenreport zwar auch Honduras und Nordkorea gelistet sind, liegen weiterhin acht der zehn am stärksten vernachlässigten Krisen in Afrika. Ein zentraler gemeinsamer Nenner: Der Klimawandel wirkt als massiver Krisenverstärker – durch häufigere und intensivere Wetterextreme, Ernteausfälle sowie steigenden Druck auf die Versorgung mit Wasser und Nahrung.
So auch in Simbabwe, wo Dürre die Ernährungssicherheit von Millionen Menschen, insbesondere in ländlichen Gebieten, gefährdet. „Es war erschütternd zu sehen, wie das Ausmaß der durch El Niño verursachten Dürre 2023/24 in Simbabwe medial weitgehend übersehen wurde. Millionen Menschen waren von den Folgen noch im Jahr 2025 betroffen, Gemeinden kämpften um Zugang zu sauberem Wasser und Nahrung. Die geringe internationale Aufmerksamkeit ist nicht gerade hilfreich, wenn notleidende Familien dringend auf Unterstützung hoffen“, sagte Charlene Pellsah Ambali, stellvertretende CARE-Länderdirektorin in Simbabwe. „Die Welt muss solche Katastrophen wahrnehmen – erst dann entsteht der Druck, schnell und ausreichend zu handeln.“
Vergessene Krisen sichtbar machen
Auch die Europäische Union betont die Bedeutung, vergessene Krisen sichtbar zu machen und humanitäre Hilfe dort zu stärken, wo Aufmerksamkeit fehlt. „Vergessene Krisen sind oft komplex und langwierig. Von den Medien – und häufig auch von Geldgebern – werden sie übersehen, bleiben aber dennoch harte Realität. Für die notleidenden Menschen sind diese Krisen keineswegs ‚vergessen‘“, sagte Hans Das, stellvertretender Generaldirektor und Chief Operations Officer für Katastrophenschutz und humanitäre Hilfe der Europäischen Kommission (DG ECHO). CAREs jährlicher Bericht über vergessene Krisen ist eine eindringliche Erinnerung an diese Realität und ein wertvolles Instrument, damit zumindest etwas Licht ins Dunkel gebracht wird.“
Die zehn humanitären Krisen:
1. Zentralafrikanische Republik – Jede fünfte Person ist auf der Flucht.
2. Namibia – 1,3 Millionen Menschen haben zu wenig zu essen.
3. Sambia – 5,5 Millionen Menschen müssen mit Hilfsgütern versorgt werden.
4. Malawi – Vier Millionen Menschen sind von Ernährungsunsicherheit betroffen.
5. Honduras – Über 50 Prozent der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze.
6. Nordkorea – Fast 11 Millionen Menschen sind von Unterernährung betroffen.
7. Angola – 2,6 Millionen Menschen – die Hälfte davon Kinder – sind in Not.
8. Burundi – 1,2 Millionen Menschen haben nicht genug zu essen.
9. Simbabwe – Ein Viertel der Kinder unter fünf Jahren ist mangelernährt.
10. Madagaskar – Rund jede siebte Person ist auf humanitäre Hilfe angewiesen.
Politik
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien
Berlin 28.01.2026
Umfassender Marktzugang und tiefere wirtschaftliche Zusammenarbeit –
Politischer Abschluss der Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen
zwischen der EU und Indien. Die EU und Indien haben heute am Rande des EU-Indien Gipfels in Neu-Delhi den politischen Abschluss der Verhandlungen über ein wegweisendes Freihandelsabkommen bekanntgegeben.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche: „Das Freihandelsabkommen zwischen der EU
und Indien markiert einen nächsten großen Schritt für Europas wirtschaftliche Resilienz. Mit fast zwei Milliarden Menschen entsteht eine der größten Freihandelszonen der Welt. Das Abkommen macht deutlich: Europa handelt entschlossen und stellt seine Partnerschaften breiter auf. Davon profitiert unsere Exportwirtschaft – und Europas Position in der globalen Wirtschaft.“
Das Abkommen verbessert den Marktzugang zum indischen Markt insbesondere für die
exportorientierten Branchen der deutschen Wirtschaft – darunter Maschinenbau, Chemie /
Pharmazie, Elektrotechnik. Luft- und Raumfahrt sowie die Fahrzeug- und Zulieferindustrie.
Nach vollständiger Umsetzung werden Zölle auf rund 96,6 % der EU-Ausfuhren nach Indien
abgeschafft oder gesenkt. Darüber hinaus zielt das Abkommen darauf ab, bestehende
Handelshemmnisse zu reduzieren und Verfahren im bilateralen Handel zu erleichtern, um
den Marktzugang für Unternehmen praktikabler zu gestalten. Dies ist vor allem auch für
mittelständische Unternehmen ein wichtiger Fortschritt.
Die Einigung schließt sich an die erfolgreichen Verhandlungsabschlüsse mit Indonesien und
MERCOSUR und Indien an und fügt sich in die Freihandelsagenda der Europäischen Union
und Deutschlands ein.
-

 Politik7 Tagen ago
Politik7 Tagen agoDeutsch-Romänische Gespräch
-
Politik6 Tagen ago
Deutsch-ukrainische Gespräch
-

 Berlin6 Tagen ago
Berlin6 Tagen agoKinder: Opfer der Gier
-
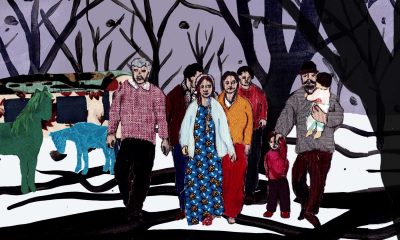
 Kunst19 Stunden ago
Kunst19 Stunden agoAICA Deutschland zeichnet Kunstmuseum Wolfsburg aus
-
Politik6 Tagen ago
Cyber- und Sicherheitspakt: Deutschland und Israel proben den Ernstfall
-
Wirtschaft6 Tagen ago
ifo Institut: Familienunternehmen in Europa erwarten ein besseres Wirtschaftsjahr 2026
-
Politik6 Tagen ago
Exportkontrolle von Rüstungs- und Dual use-Gütern
-
Wirtschaft22 Stunden ago
ifo Institut: Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie setzt Abwärtstrend fort
-

 Berlin19 Stunden ago
Berlin19 Stunden agoWenn Gesundheit zur Reise-Motivation wird
-
Politik6 Tagen ago
Arbeitsmarkt weiter unter Druck
-
Politik22 Stunden ago
Pressestimmen zum Iran und der US-Regierung
-
Politik22 Stunden ago
Bundeskanzler Merz reist in die Golfstaaten
-
Politik22 Stunden ago
Angriffe gegen Kunst durch die Mullahs Regime
-
Politik22 Stunden ago
Die Vereinigten Staaten, Europa und die Welt
-
Politik22 Stunden ago
DFPV will Vertiefung der deutsch-französischen Beziehungen