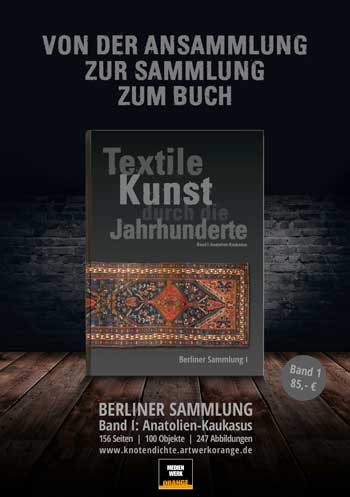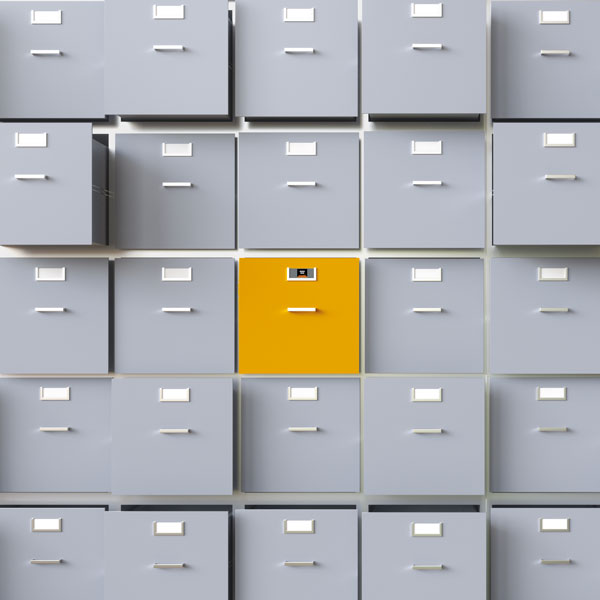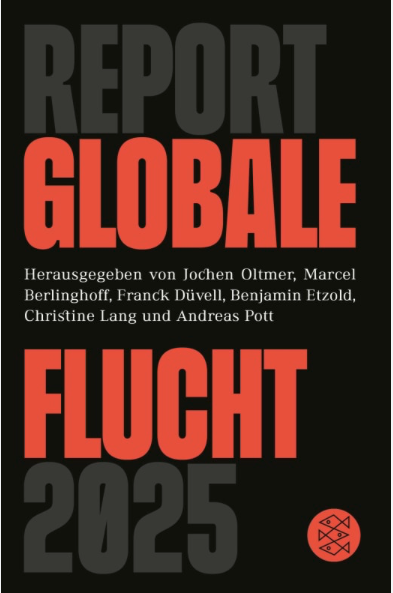Wirtschaft
Weniger Fahrgäste im Linien-Nahverkehr
Wiesbaden, Berlin 08.10.2025
– Im Jahr 2024 waren in Deutschland mit 11,5 Milliarden Fahrgästen rund 2 % weniger Fahrgäste im Liniennahverkehr mit Bussen und Bahnen unterwegs als im Vor-Corona-Jahr 2019. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, stieg dagegen die Beförderungsleistung, also die Strecke, die alle Fahrgäste gemeinsam zurücklegten, im Liniennahverkehr insgesamt auf 121 Milliarden Personenkilometer. Das war ein Zuwachs von 7 % gegenüber 2019.
Zunächst hatte die Corona-Krise das Mobilitätsverhalten verändert und zu einem Einbruch der Fahrgastzahlen geführt. Ab 2022 stiegen die Fahrgastzahlen dann wieder an, wozu das 9-Euro-Ticket, das im Sommer des Jahres 2022 angeboten wurde, und das im Mai 2023 eingeführte Deutschland-Ticket beigetragen haben dürften. Im 1. Halbjahr 2025 gingen die Zuwächse der Fahrgastzahlen aber zurück (Pressemitteilung vom 22. September 2025).
Stärkster Rückgang beim Fahrgastaufkommen mit Straßenbahnen
Alle Verkehrsmittel im Liniennahverkehr verloren im Vergleich zu 2019 Fahrgäste, jedoch in unterschiedlichem Umfang. Den stärksten Rückgang verzeichnete der Straßenbahnverkehr, den 2024 noch 3,9 Milliarden Fahrgäste nutzten und damit 5 % weniger als 2019. Mit 5,4 Milliarden Fahrgästen war 2024 der Bus das am häufigsten genutzte Verkehrsmittel im Nahverkehr. Hier sank das Fahrgastaufkommen gegenüber 2019 um 1 %. Im gleichen Umfang ging die Zahl der Fahrgäste im Liniennahverkehr mit Eisenbahnen zurück. In dem von Streiks beeinträchtigten Jahr 2024 gab es hier rund 2,8 Milliarden Fahrgäste.
Gestiegene Reiseweiten und Beförderungsleistungen im Nahverkehr mit Eisenbahnen und Bussen
Die Beförderungsleistung im Nahverkehr insgesamt, also die Strecke, die alle Fahrgäste gemeinsam zurücklegten, lag 2024 um 7 % über der des Vor-Corona-Jahres 2019. Insgesamt betrug die durchschnittliche Reiseweite je Fahrgast im Jahr 2024 rund 10,5 Kilometer. Im Eisenbahnnahverkehr legten die Reisenden im Jahr 2024 zusammen 64 Milliarden Personenkilometer zurück, das waren 12 % mehr als im Vor-Corona-Jahr 2019. Die durchschnittliche Reiseweite je Fahrgast im Eisenbahnnahverkehr betrug im Jahr 2024 rund 23 Kilometer. Damit reisten Fahrgäste im Durchschnitt 3 Kilometer weiter als im Vor-Corona-Jahr 2019.
Im Busverkehr stieg die Beförderungsleistung gegenüber 2019 um 4 % auf 40 Milliarden Personenkilometer. Die durchschnittliche Reiseweite nahm im selben Zeitraum um 5 % zu, von knapp unter 7 auf rund 7,3 Kilometer.
Bei Straßenbahnen lag die Beförderungsleistung um 5 % unter den Ergebnissen des Vor-Corona Jahres 2019. Die durchschnittliche Reiseweite blieb unverändert bei 4,2 Kilometern.
Wirtschaft
ifo Institut: Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie setzt Abwärtstrend fort
München 04.02.2026
– Knapp jedes dritte Industrieunternehmen berichtet von einem Rückgang seiner Wettbewerbsfähigkeit. Im Januar gaben 31,2 Prozent an, gegenüber Ländern außerhalb der EU weniger wettbewerbsfähig zu sein. Innerhalb Europas liegt der Anteil bei 17,2 Prozent. „Nur wenige Unternehmen sehen eine Verbesserung ihrer Lage auf den Weltmärkten“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. „Der schleichende Verlust der Wettbewerbsfähigkeit setzt sich fort.“
Über nahezu alle Branchen hinweg hat die Wettbewerbsfähigkeit nachgelassen. Besonders schwierig bleibt die Lage im Bereich Metallerzeugung und -bearbeitung. Hier berichten rund 47 Prozent der Unternehmen, dass die internationale Wettbewerbsfähigkeit sinkt. Ähnlich hoch ist der Anteil in der chemischen Industrie (45 Prozent). Im Maschinenbau liegt der Anteil bei rund 40 Prozent. Einen positiven Lichtblick gab es in der Automobilbranche. Die Unternehmen berichten, dass sich ihre Wettbewerbsposition im Durchschnitt zumindest innerhalb von Europa verbessert hat. Außerhalb von Europa hat sie sich jedoch weiter verschlechtert. „Deutschland droht mittelfristig den Anschluss zu verlieren“, so Wohlrabe weiter. „Tiefgreifende Reformen sind das Gebot der Stunde.“
Politik
Einstieg des Bundes bei TenneT Germany
Berlin 04.02.2026
– Die KfW hat am 3. Februar im Auftrag der Bundesregierung den Vertrag zum Erwerb eines Anteils von 25,1% an der TenneT Germany von der niederländischen TenneT Holding unterzeichnet. Mit über 14.000 Trassenkilometern betreibt TenneT Germany das größte deutsche Strom-Übertragungsnetz.
Mit dieser Minderheitsbeteiligung wird der Bund gemäß seiner Anteile Einflussmöglichkeiten auf die TenneT Germany erhalten. Neben Mitbestimmungsrechten in Bezug auf die Geschäftsführung und den Geschäftsplan des Unternehmens kann der Bund beispielsweise stimmberechtigte Vertreterinnen bzw. Vertreter in das Gesellschafter- und Aufsichtsgremium entsenden.
Bundesministerin Katherina Reiche:
„Für das Erreichen der energiepolitischen Ziele ist der bedarfsgerechte Ausbau der Stromnetze erforderlich. Der Einstieg des Bundes bei Tennet trägt dazu bei, den milliardenschweren Kapitalbedarf in den kommenden Jahren abzusichern. Mit dieser Investition in die Infrastruktur der Zukunft stärken wir den Standort Deutschland.“
KfW-Vorstandsvorsitzender Stefan Wintels:
„Diese Beteiligung ist ein Meilenstein für Versorgungssicherheit und Resilienz der deutschen und europäischen Energieinfrastruktur. Mit unserer Beteiligung im Auftrag des Bundes und gemeinsam mit drei weiteren institutionellen Investoren leisten wir einen wichtigen Beitrag für langfristige Stabilität, Wettbewerbsfähigkeit und nachhaltiges Wachstum. Das Volumen der Transaktion unterstreicht die Attraktivität Deutschlands als Wirtschafts- und Investitionsstandort und zeigt, wie staatliches und institutionelles Kapital verantwortungsvoll zusammenwirkt. Wir freuen uns, den Bund bei diesem wichtigen Vorhaben mit unserer Expertise zu unterstützen.“
Der Haushaltsausschuss des Bundestages hatte bereits in seiner Sitzung am 16. Januar die entsprechenden Haushaltsmittel entsperrt und so den Weg für die Unterzeichnung freigemacht. Der Bund sichert dabei durch eine Risikoübernahme den Anteilserwerb durch die KfW und die zugesagten Kapitaleinlagen ab, ohne dass dafür Mittel aus dem Bundeshaushalt abfließen. Die Refinanzierungs- und Verwaltungskosten der KfW dagegen werden aus dem Bundeshaushalt getragen. Die Angemessenheit des Kaufpreises wurde unter anderem durch die Einholung zweier sogenannter Fairness Opinions geprüft. Die Wirtschaftlichkeit der Beteiligung wurde zudem durch entsprechendes Gutachten bestätigt.
Im September 2025 hatte die niederländische Regierung bekannt gegeben, dass der norwegische Staatsfonds Norges, der niederländische Pensionsfonds APG sowie der singapurische Staatsfonds GIC bis 2029 Anteile in Höhe von insgesamt bis zu 46 % an TenneT Germany erwerben wollen. Die privaten Investoren haben ebenfalls Kapitaleinlagen von bis zu € 9,50 Mrd. zugesagt. Der Bund wird seinen Anteil von 25,1% an TenneT Germany zur gleichen Kaufpreis-Bewertung erwerben wie die Mitinvestoren. Der übrige Anteil verbleibt bei der niederländischen TenneT Holding.
Wie bei Unternehmensbeteiligungen üblich müssen nun noch regulatorische Genehmigungen eingeholt werden, um den Erwerb der TenneT Germany Anteile vollziehen zu können. Mit diesem Schritt wird derzeit spätestens im dritten Quartal 2026 gerechnet. Neben den bereits bestehenden Beteiligungen des Bundes über die KfW an 50Hertz (20 %) und TransnetBW (24,95 %) wäre der Bund dann an drei der vier deutschen Stromübertragungsnetzbetreiber beteiligt.
Welt
Absatz von Fairtrade-Kakao 2025 deutlich gestiegen
· Trotz hoher Rohstoffpreise: Fairtrade-Kakaoabsatz in Deutschland steigt 2025
· 30 Jahre Fairtrade-Kakao als Fundament für resiliente Lieferketten und bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen im Kakaoanbau
Berlin 04.02.2026
Fairtrade Deutschland blickt optimistisch auf die Absatzentwicklung von fairem Kakao: Trotz hoher Rohstoffpreise und anhaltender Herausforderungen in den globalen Lieferketten prognostiziert die Organisation für 2025 einen deutlichen Anstieg des Fairtrade-Kakaoabsatzes um rund 11,7 Prozent auf 99.000 Tonnen.
Von dem Wachstum profitieren die Fairtrade-Kakaokooperativen: Rund 22 Mio. Euro Prämien-Gelder erwirtschafteten sie für ihre Kakaoverkäufe 2025, so die Prognose. Die Prämie erhalten sie zusätzlich zum Verkaufspreis. Sie fließt unter anderem in bessere Einkommen, Bildungsprojekte, Klimaanpassungsmaßnahmen und die Stärkung lokaler Strukturen.
„Wir sehen sehr klar: Verbraucher*innen greifen auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten weiterhin zu Schokolade mit echtem Kakao – und setzen dabei zunehmend auf Produkte mit dem Fairtrade-Siegel“, sagt Claudia Brück, Vorständin bei Fairtrade Deutschland „Drei Jahrzehnte Erfahrung im Kakaomarkt machen Fairtrade zu einem stabilen Partner – gerade in Zeiten hoher Unsicherheit.“
30 Jahre Fairtrade-Kakao: Von den ersten Tafeln zum Marktstandard
2026 feiert Fairtrade Deutschland 30 Jahre Fairtrade-Kakao. 1996 kamen die ersten gesiegelten Tafeln Schokolade und Trinkschokoladen auf den deutschen Markt. Im Jahr 2024 erreichte Fairtrade-Kakao einen Marktanteil von 21 Prozent. Inzwischen bieten 185 Partner Produkte mit fair gehandeltem Kakao an.
Ein Meilenstein war die Einführung des Fairtrade-Kakao-Programms im Jahr 2014, das Partnern den Einstieg in Fairtrade-Kakao erleichtert hat und einherging mit der Einführung des Rohstoff-Siegels. Das Fairtrade-Siegel auf weißem Grund zeigt an, dass die auf dem Etikett genannte Zutat aus fairem Handel stammt. Seither können Unternehmen Fairtrade-Kakao als Einzelrohstoff beziehen und über mehrere Sortimente hinweg oder für die Gesamtproduktion verwenden. Bereits im ersten Jahr des Programms stieg der Absatz um das Zwanzigfache.
In den vergangenen drei Jahrzehnten wurden über 570.000 Tonnen Fairtrade-Kakao in Deutschland abgesetzt. Die daraus resultierenden Prämienzahlungen von mehr als 130 Millionen Euro haben maßgeblich zur Stärkung der Kakaokooperativen beigetragen.
Fairtrade-Strategie zur Existenzsicherung
Die Einkommenssituation von Kakaobauern und -bäuerinnen bleibt eine massive Herausforderung. Um dieser zu begegnen und Einkommen sowie Lebensbedingungen zu verbessern, hat Fairtrade eine Strategie für existenzsichernde Einkommen ins Leben gerufen.
Diese umfasst die Berechnung eines Kakaopreises, in den essentielle Faktoren wie Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln, sauberem Wasser, sicheren Wohnverhältnissen, Bildung, medizinischer Versorgung sowie finanzielle Rücklagen für unerwartete Ereignisse und Altersvorsorge miteingerechnet werden.
Neben den monetären Aspekten fördert die Fairtrade-Strategie auch nachhaltige Anbaumethoden und stellt langfristige Handelspartnerschaften her, die größere Abnahmemengen ermöglichen. Fairtrade-Partner investieren in begleitende Programme, die sowohl einzelne Bäuerinnen und Bauern, als auch die Gemeinschaft der Kooperativen stärken.
Wirtschaft
ifo Institut: Geschäftsklima in der Chemie leicht verbessert
Berlin, München 04.02.2026
– Das Geschäftsklima in der Chemischen Industrie hat sich im Januar geringfügig verbessert. Der Index stieg auf minus 23,5 Punkte, nach minus 24,6* Punkten im Dezember. Dabei trübte sich die aktuelle Lage deutlich ein und fiel auf minus 34,9 Punkte, nach minus 29,7* Punkten im Dezember. Die Erwartungen hellten sich dagegen auf, von minus 19,3* auf minus 11,4 Punkte im Januar. „Die Chemie blickt etwas weniger pessimistisch in die Zukunft, doch die laufenden Geschäfte bleiben schwach“, sagt ifo-Branchenexpertin Anna Wolf.
Herrschte zum Jahresende 2025 noch Krisenstimmung, so stabilisiert sich die Nachfrage im Januar leicht. Erstmals seit Monaten stieg der Auftragsbestand. Der Indikator verbesserte sich von minus 23,7 auf plus 3,4 Punkte. Die Auftragsbücher sind für 1,8 Monate gefüllt, im Oktober waren es noch 1,4 Monate. Trotz dieser positiven Signale bewerten die Unternehmen den gesamten Auftragsbestand mit minus 47,1 Punkten weiterhin als sehr niedrig. Die Kapazitätsauslastung in der Chemischen Industrie liegt mit 72,7 Prozent deutlich unter dem langfristigen Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre von 80,9 Prozent. Die Unternehmen planen, die Produktion in den nächsten Monaten zurückzufahren und Personal weiter zu reduzieren. „Der anhaltende Preisdruck und die Unsicherheiten im Außenhandel durch drohende Zölle belasten die Chemische Industrie“, sagt Wolf.
Wirtschaft
ifo Institut: Familienunternehmen in Europa erwarten ein besseres Wirtschaftsjahr 2026
München 30.01.2026
– Familienunternehmen in Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien rechnen mehrheitlich mit einer besseren wirtschaftlichen Entwicklung. Das geht aus einer Umfrage der Stiftung Familienunternehmen unter 2.000 Familienunternehmen hervor, durchgeführt von Edelman Data & Intelligence in Zusammenarbeit mit dem ifo Institut. In den vier wirtschaftlich stärksten Ländern Europas erwartet mehr als jedes zweite (55 Prozent) befragte Familienunternehmen eine Verbesserung seiner Geschäftslage für das erste Halbjahr 2026. Weniger als ein Drittel geht von einer gleichbleibenden Entwicklung aus. Nur 13 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung.
„Noch optimistischer sind die Unternehmen mit Blick auf die kommenden fünf Jahre. Hier erwarten etwa zwei Drittel der Familienunternehmen in Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien eine bessere Wirtschaftsentwicklung“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Befragungen. Der Anteil der Firmen, die mit einer besseren langfristigen Geschäftsentwicklung rechnen, liegt in Deutschland bei 66 Prozent, in Spanien bei 72 Prozent, in Italien bei 67 Prozent und in Frankreich bei 63 Prozent.
Wichtigste EU-Reformen, um die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, sind für zwei Drittel der befragten Familienunternehmen Bürokratieabbau sowie schnellere und einfachere Genehmigungsverfahren. „Auch wenn die Familienunternehmen in Europa die vielen bürokratischen Vorhaben der EU kritisch für die eigene Wettbewerbsfähigkeit sehen, bewertet eine Mehrheit die Arbeit der EU in den letzten fünf Jahren als positiv“, sagt Wohlrabe.
Die Umfrage untersuchte auch, welche Risiken die Familienunternehmen für die eigene Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der nächsten fünf Jahre sehen. Am häufigsten nannten die Befragten steigende Energiepreise, dicht gefolgt vom Mangel an Fachkräften und IT-Sicherheitsrisiken. Danach folgen geopolitische Risiken, Zölle und Handelshemmnisse sowie verschiedene Facetten von Regulierung und Bürokratie. Besonders in Deutschland werden die Kosten von Bürokratie häufiger genannt als in den anderen Ländern.
Die Umfrage wurde zwischen dem 28. Mai und 7. Juli 2025 durchgeführt. Die Auswertung umfasst insgesamt knapp 2.000 Familienunternehmen. Jedes der vier Länder ist mit etwa 500 Unternehmen vertreten.
Politik
Exportkontrolle von Rüstungs- und Dual use-Gütern
Berlin 30.01.2026
Maßnahmenpaket zur Beschleunigung und Vereinfachung tritt zum 1. Februar in Kraft
Genehmigungsverfahren für Rüstungsgüter und Dual use Güter werden beschleunigt – Erleichterungen u.a. für europäische Rüstungskooperationen und Cloud-Nutzung zum Technologieaustausch vorgesehen. Gemeinsam mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) setzt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE) zum 1. Februar 2026 verschiedene Maßnahmen in Kraft, die die Exportkontrolle von Rüstungs- und Dual use-Gütern vereinfachen und beschleunigen.
Dr. Thomas Steffen, Staatssekretär im BMWE: „Mit dem Maßnahmenbündel passen wir die Exportkontrolle an die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen an, indem wir vor allem europäische Kooperationen stärken. Zugleich schaffen wir durch neue Genehmigungsformen und gestraffte Verfahren mehr Verlässlichkeit für die Ausführer. Auf diese Weise bauen wir Bürokratie ab, konzentrieren Ressourcen und schaffen Erleichterungen für Unternehmen, wo immer dies unter Einhaltung hoher Prüfstandards möglich ist. Hierbei wird das BAFA weiterhin risikoorientiert vorgehen und die beteiligten Bundesressorts angemessen einbeziehen.“
Als Teil des Maßnahmenbündels werden weitere Allgemeine Genehmigungen (AGGs) eingeführt und bestehende AGGs aktualisiert. AGGs sind pauschale Ausfuhrgenehmigungen für Rüstungsgüter und Dual use-Güter, die von Exporteuren in Anspruch genommen werden können, ohne beim BAFA einen Ausfuhrantrag stellen zu müssen. Sie gelten für den unkritischen, gleichwohl genehmigungspflichtigen Export ausgewählter Güter in ausgewählte Länder. Dies eröffnet die Möglichkeit, die Kontrollressourcen auf die Exporte zu konzentrieren, die einer vertieften Bewertung bedürfen.
Als weiteres wesentliches Element werden die Entscheidungsbefugnisse des BAFA gestärkt, um die Genehmigungsverfahren zu vereinfachen und zu verkürzen. Insbesondere über den Austausch von Technologie kann so künftig schneller entschieden werden, wenn er innereuropäisch oder konzernintern erfolgt. Einen weiteren Schwerpunkt stellen Verfahrenserleichterungen für Gemeinschaftsprojekte dar. So soll mit einem neuen Verfahren der bürokratische Aufwand für nationale Teilnehmer an amtlich anerkannten Gemeinschaftsprojekten erheblich verringert werden. Hierzu wird das Instrument der „Sondergenehmigung“ geschaffen.
Im Detail zu Änderungen der AGGs:
Es wird eine neue AGG für Anträge auf die Verbringung und Ausfuhr von Technologie und Software im Rahmen des Europäischen Verteidigungsfonds eingeführt. Auch der Upload bzw. die Datenspeicherung auf näher definierten Servern in europäischen Staaten wird geregelt und erleichtert. Die AGG Nr. 21 wird dahingehend erweitert, dass sie stärker für Schutzausrüstung nutzbar ist. Mit dem Beitritt des Vereinigten Königreich zum Übereinkommen über Ausfuhrkontrollen im Rüstungsbereich wird die korrespondierende AGG Nr. 28 auch für entsprechende Ausfuhren in das Vereinigte Königreich nutzbar. Vorübergehende Ausfuhren und Verbringungen (AGG Nr. 24) sind künftig in zusätzliche Länder möglich. Für eine zeitnahe Umsetzung der Regimeentscheidung des Wassenaar Plenary vom 5.12.25 zur Entlistung bestimmter Laser vom Anhang I EU-Dual-Use-Verordnung und einer damit verbundenen möglichen Verfahrenserleichterung wird bis zum Inkrafttreten des überarbeiteten Anhangs I der Verordnung in 2026 der Güterkreis der AGG Nr. 17 um diese Laser erweitert.
Politik
Arbeitsmarkt weiter unter Druck
Die Arbeitsmarktzahlen im Januar 2026
Berlin 30.01.2026
Mit der beginnenden Winterpause ist die Zahl arbeitsloser Menschen im Januar 2026 gestiegen. Insgesamt waren 3,085 Millionen Menschen arbeitslos – das waren 177.000 mehr als vor einem Monat. Die Arbeitslosenquote ist gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozentpunkte gestiegen und liegt nun bei 6,6 Prozent.
Ein kräftiger Anstieg der Arbeitslosigkeit ist im Januar aufgrund der Witterungsbedingungen üblich. Saisonbereinigt blieb die Zahl der Arbeitslosen weitgehend unverändert.
Die Unterbeschäftigung, die u. a. auch Personen in arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen umfasst, hat sich gegenüber dem Vormonat um 128.000 erhöht. Saisonbereinigt nahm die Unterbeschäftigung im Vergleich zum Vormonat um 4.000 ab. Im Vergleich zum Vorjahr fiel sie um 8.000 geringer aus. Damit setzt sich der Trend einer leicht abnehmenden Unterbeschäftigung weiter fort.
Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ist von Oktober auf November um 22.000 auf 35,21 Millionen gesunken. Ohne Beschäftigungsaufnahmen von ausländischen Staatsbürgern würde die Zahl der Beschäftigten in Deutschland jedoch schon seit längerem sinken. Im November waren erstmals sechs Millionen Ausländerinnen und Ausländer in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Ihre Zahl ist im Vergleich zum Vorjahr um 257.000 gestiegen. Dieser Zuwachs geht ganz auf Personen aus sogenannten Drittstaaten zurück. Insgesamt waren 804.000 Menschen aus den acht wichtigsten Asylherkunftsländern (plus 69.000 im Vergleich zum Vorjahr) und 374.000 Ukrainerinnen und Ukrainer (plus 78.000 im Vergleich zum Vorjahr) in Deutschland sozialversicherungspflichtig oder geringfügig beschäftigt. Das zeigt: Die Bemühungen um die Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt wirken.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas: „Die deutsche Wirtschaft zeigte zum Jahresende eine leichte Aufwärtsbewegung. Auf dem Arbeitsmarkt macht sich dies allerdings auch wegen des Wintereinbruchs noch nicht bemerkbar. Saisonbereinigt stagnieren die Arbeitslosenzahlen. Als Bundesregierung investieren wir mit 500 Milliarden Euro gegen die Konjunkturflaute an und bauen unnötige Bürokratie ab. Darüber hinaus investieren wir in Qualifizierung und Weiterbildung, um den Strukturwandel zu gestalten und die Beschäftigten fit zu machen für den Arbeitsmarkt von morgen. An die Arbeitgeber appelliere ich, auch in Zeiten der Krise in Ausbildung zu investieren. Denn die Auszubildenden von heute sind die Fachkräfte von morgen, und die werden angesichts des demographischen Wandels dringend gebraucht.“
Politik
Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien
Berlin 28.01.2026
Umfassender Marktzugang und tiefere wirtschaftliche Zusammenarbeit –
Politischer Abschluss der Verhandlungen zu einem Freihandelsabkommen
zwischen der EU und Indien. Die EU und Indien haben heute am Rande des EU-Indien Gipfels in Neu-Delhi den politischen Abschluss der Verhandlungen über ein wegweisendes Freihandelsabkommen bekanntgegeben.
Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche: „Das Freihandelsabkommen zwischen der EU
und Indien markiert einen nächsten großen Schritt für Europas wirtschaftliche Resilienz. Mit fast zwei Milliarden Menschen entsteht eine der größten Freihandelszonen der Welt. Das Abkommen macht deutlich: Europa handelt entschlossen und stellt seine Partnerschaften breiter auf. Davon profitiert unsere Exportwirtschaft – und Europas Position in der globalen Wirtschaft.“
Das Abkommen verbessert den Marktzugang zum indischen Markt insbesondere für die
exportorientierten Branchen der deutschen Wirtschaft – darunter Maschinenbau, Chemie /
Pharmazie, Elektrotechnik. Luft- und Raumfahrt sowie die Fahrzeug- und Zulieferindustrie.
Nach vollständiger Umsetzung werden Zölle auf rund 96,6 % der EU-Ausfuhren nach Indien
abgeschafft oder gesenkt. Darüber hinaus zielt das Abkommen darauf ab, bestehende
Handelshemmnisse zu reduzieren und Verfahren im bilateralen Handel zu erleichtern, um
den Marktzugang für Unternehmen praktikabler zu gestalten. Dies ist vor allem auch für
mittelständische Unternehmen ein wichtiger Fortschritt.
Die Einigung schließt sich an die erfolgreichen Verhandlungsabschlüsse mit Indonesien und
MERCOSUR und Indien an und fügt sich in die Freihandelsagenda der Europäischen Union
und Deutschlands ein.
Wirtschaft
Höhere Zuwachsrate bei Pflegehelferinnen und -helfern als bei examinierten Pflegekräften
Berlin 28.01.2026
Die Zahl der auf die volle Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten (Vollzeitäquivalente) lag Ende 2024 bei gut 4,4 Millionen und erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 1,4 % (2021: +1,9 %, 2022: +0,4 %, 2023: +0,5 %).
Personalzuwachs in allen (teil-)stationären Einrichtungen
Im Jahr 2024 ist die Zahl der Beschäftigten in (teil-)stationären Einrichtungen mit einem Zuwachs von 64 000 oder 3,0 % wesentlich stärker gestiegen als im ambulanten Sektor (+32 000 oder +1,3 %). In allen (teil-)stationären Einrichtungen hat die Zahl der Beschäftigten zugenommen: in Krankenhäusern um 38 000 Personen oder 2,9 %, in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen um 5 000 Personen oder 4,2 % und in (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen um 21 000 Personen oder 2,8 %.
Zuwachs in ambulanten Einrichtungen insbesondere in der Pflege und in Praxen sonstiger medizinischer Berufe
Die Entwicklung der Beschäftigtenzahl war im Jahr 2024 in den verschiedenen Bereichen des ambulanten Sektors unterschiedlich. Beschäftigungszuwächse gab es in der ambulanten Pflege (+11 000 oder +2,6 %), in Praxen sonstiger medizinischer Berufe, zum Beispiel in der Physio- und Ergotherapie (+14 000 oder +2,4 %) sowie in Arztpraxen und Zahnarztpraxen (jeweils +4 000 oder +0,5 % bzw. +1,0 %). Hingegen blieb das Personal in Apotheken mit insgesamt 237 000 Beschäftigten und im Einzelhandel mit augenoptischen, medizinischen und orthopädischen Artikeln mit insgesamt 136 000 Beschäftigten unverändert.
Die Zahl der Pflegekräfte in Krankenhäusern, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sowie in ambulanten und (teil-)stationären Pflegeeinrichtungen ist gegenüber dem Vorjahr deutlich angestiegen. Insgesamt arbeiteten in diesen Einrichtungen 49 000 oder 3,4 % Pflegekräfte mehr als im Jahr 2023. Hierbei stieg die Zahl der Pflegehelferinnen und -helfer mit +5,2 % deutlich stärker als die der examinierten Pflegekräfte (+2,6 %). In absoluten Zahlen bedeutet dies einen Anstieg um 24 000 auf insgesamt 485 000 Pflegehelferinnen und -helfer und um 25 000 examinierte Pflegekräfte auf insgesamt rund 1 Million. Hiermit setzt sich der Trend der letzten zehn Jahre mit höheren Wachstumsraten bei Pflegehelferinnen und -helfern als bei examinierten Pflegekräften fort.
Wirtschaft
ifo Institut: Exporterwartungen leicht gestiegen
München 28.01.2026
– Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich etwas verbessert. Die ifo Exporterwartungen stiegen im Januar auf minus 1,2 Punkte, nach minus 3,0 Punkten im Dezember. „Auch wenn die Unternehmen weniger skeptisch bezüglich ihrer Auslandsgeschäfte sind, bleibt die Unsicherheit hoch“, sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der ifo Umfragen. „Für das erste Quartal 2026 fehlen klare Signale für einen Aufwärtstrend.“
Die Automobilbranche und die Hersteller von elektrischen Ausrüstungen blicken etwas zuversichtlicher auf das Auslandsgeschäft und planen mit wachsenden Exporten. In der Metallerzeugung und -bearbeitung geht der jahrelang anhaltende Pessimismus spürbar zurück. Die Exporterwartungen stiegen auf den höchsten Wert seit Februar 2022; positive und negative Einschätzungen halten sich derzeit die Waage. In der Getränkeindustrie erwarten die Unternehmen ein stabiles, expansives Exportumfeld. Die Hersteller von Bekleidung und Nahrungsmitteln sowie die Druckindustrie rechnen hingegen weiterhin mit rückläufigen Exporten.
Politik
Nationale Tourismusstrategie setzt klaren Kurs auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit
Berlin 28.01.2026
Der Tourismus ist nicht nur eine wichtige Säule unserer Wirtschaft, er ist mit seinen vielfältigen Möglichkeiten für menschliche Begegnungen auch aus unserem gesellschaftlichen Leben nicht wegzudenken. Die Bundesregierung will deshalb dafür sorgen, dass die deutsche Tourismuswirtschaft einen stabilen Wachstumskurs einschlagen kann und hat heute im Kabinett die Nationale Tourismusstrategie (NTS) beschlossen.
Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche: „Mit der Nationalen Tourismusstrategie stellen wir den Tourismusstandort Deutschland konsequent auf Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Wir entlasten Unternehmen, bauen Bürokratie ab und schaffen mehr Flexibilität am Arbeitsmarkt. Unser Ziel ist klar: Der Tourismus in Deutschland soll investieren, wachsen und gute Arbeitsplätze sichern können. Dafür setzen wir jetzt die richtigen wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen.“
Der Koordinator für Maritime Wirtschaft und Tourismus Christoph Ploß: „Wir schaffen mit der
Nationalen Tourismusstrategie bessere Rahmenbedingungen für die Unternehmen und Mitarbeiter der Tourismusbranche. Mehr Investitionen in die Infrastruktur, geringe Standortkostenkosten für die Luftfahrt und die Digitalisierung von Visaverfahren werden neben vielen anderen Maßnahmen dazu beitragen, dass die Tourismuswirtschaft in Deutschland in den nächsten Jahren wachsen wird. Die Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes, mit der in Zukunft eine wöchentliche statt einer täglichen Höchstarbeitszeit gilt, soll noch in diesem Jahr beschlossen werden. Diese Reform wird vor allem den kleinen und mittelständischen Betrieben sehr helfen.“
Die Strategie setzt einen Auftrag aus dem Koalitionsvertrag um, indem sie die für den Tourismus relevanten Maßnahmen aller Ressorts erstmals unter dem übergeordneten Ziel der Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit des Tourismusstandortes Deutschland bündelt. Dabei werden die fürden Tourismus wichtigen Schwerpunktthemen Unternehmensentlastung und Bürokratieabbau, Attraktivität und Anbindung des Reiselands Deutschland, Digitalisierung, Arbeitsbedingungen und Arbeitskräftegewinnung, nachhaltiger Tourismus und EU-Tourismuspolitik adressiert und alle Bereiche der Querschnittsbranche Tourismus gleichermaßen berücksichtigt.
So braucht ein wettbewerbsfähiges Reiseland eine gute Anbindung an das Ausland, leistungsfähige Verkehrsverbindungen vor Ort und einen den Ansprüchen entsprechenden Mobilitätsmix an Tourismusstandorten. Deshalb wird die Bundesregierung massiv in eine moderne, effiziente und Berlin, umweltfreundliche Verkehrsinfrastruktur investieren sowie die Digitalisierung und Elektrifizierung vorantreiben. Im Luftverkehr wird auf Kostenreduktionen, Effizienzsteigerung und regulatorische Entlastung gesetzt, um vielfältige und bezahlbare Flugverbindungen zu ermöglichen. Damit mehr Gäste nach Deutschland kommen, wird zudem die Vermarktung Deutschlands als Reiseziel verstärkt. Die Strategie konzentriert sich auf Maßnahmen in Bundeszuständigkeit. Der Bund setzt Rahmenbedingungen und hat eine koordinierende Funktion, die Länder steuern Entwicklung, Vermarktung und Finanzierung des Tourismus und haben ihre eigenen Tourismusstrategien.
Politik
Krisen, Katastrophen und Konflikte

Berlin 27.01.2026
Wie sich Unternehmen in Zeiten der Unsicherheit schützen können.
Dies war das Thema des Seminars „Sicherheit und Verteidigung als starker Faktor im Staat – Herausforderungen und Chancen für Unternehmen und Regierungen“, das heute in Berlin stattfand.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius betonte, dass Deutschland nicht länger schweigt. Es ist tief in den Krieg Russlands gegen die Ukraine involviert. Die Verteidigung der Ukraine durch militärische und andere Formen der Unterstützung ist eine Verteidigung Deutschlands und der Werte der Freiheit innerhalb der Europäischen Union.
Der Verteidigungsminister rief die Arbeitgeber auf, die Bundeswehr zu unterstützen und das Vertrauen sowie die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Militär und Industrie zu fördern. Er forderte die Rüstungsindustrie auf, ihre Technologien weiterzuentwickeln, um mit der europäischen, amerikanischen und asiatischen Rüstungsindustrie mithalten zu können.
Der Präsident der Bundeswirtschaftskammer, Peter Adrian, erklärte, die Entwicklung deutscher Rüstungstechnologien sei eine Priorität für die deutsche Industrie, um Deutschlands Ruf als „Made in Germany“ zu wahren. Wir leben in Kriegen, und es ist Deutschlands Pflicht, sich militärisch und politisch für den Frieden einzusetzen, nicht für Kriege.
Foto: © PWO
Politik
Deutschland und Dänemark schließen bilaterale Vereinbarung
Investition in Bornholm Energy Island und stärken europäische Energiesicherheit
Berlin 27.01.2026
– Bundesministerin für Wirtschaft und Energie Katherina Reiche und der dänische Energieminister Lars Aagaard haben beim Nordsee-Gipfel im Beisein von Bundeskanzler Friedrich Merz und der dänischen Premierministerin Mette Frederiksen eine Vereinbarung zu Bornholm Energy Island getroffen. Die Einigung bedeutet einen wegweisenden Schritt zur Vertiefung der deutsch-dänischen Partnerschaft und zur Umsetzung der gemeinsamen Ziele für einen saubereren, sichereren und wettbewerbsfähigeren Kontinent. Das erste grenzüberschreitende Projekt seiner Art erhöht Europas Energieunabhängigkeit, treibt Innovation voran und schafft Resilienz in Zeiten geopolitischer Herausforderungen.
Katherina Reiche, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie: „Bornholm Energy Island ist ein Flaggschiff europäischer Kooperation und ein strategisches Projekt für unsere gemeinsame Sicherheit. In einer Welt wachsender geopolitischer Spannungen übernehmen Deutschland und Dänemark Verantwortung für Europas Energiezukunft. Grenzüberschreitende Vorhaben wie dieses verringern kritische Abhängigkeiten, stärken unsere strategische Autonomie und machen Europa widerstandsfähiger gegenüber politischem und wirtschaftlichem Druck. Damit senden wir ein klares Signal: Europa handelt geschlossen, souverän und vorausschauend.“
Lars Aagaard, Minister für Klima, Energie und Versorgung: “Bornholm Energy Island markiert eine neue Ära der Verbindung und gemeinsamen Energiesicherheit. Zusammen vertiefen wir die Verbindung zwischen unseren Ländern und zeigen, dass große grenzüberschreitende Projekte möglich sind. Zu einer Zeit, in der internationale Kooperation unter Druck gerät, ist Bornholm Energy Island ein Zeichen für Europas Einheit und Entschlossenheit. Wir setzen unsere gemeinsame Vision um, zum Wohl der Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen in beiden Ländern und ganz Europa.“
Durch die Verbindung des deutschen und des dänischen Energienetzes schafft Bornholm Energy Island einen neuen Standard für grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa. Die erhöhte Vernetzung stärkt die Versorgungssicherheit und die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den beiden Ländern und fügt sich in die allgemeinen europäischen Bemühungen für eine stärkere Integration des Energiemarkts ein. Mit einer zusätzlichen Gesamtkapazität von 3 GW Offshore-Windanlagen, die an Dänemark und Deutschland angeschlossen werden, liefert die Energy Island verlässliche Elektrizität um etwa 3 Millionen Haushalte zu versorgen.
Mit der Partnerschaft gehen Deutschland und Dänemark beim Aufbau robuster Lieferketten und enger Industriekooperation in ganz Europa voran. Durch neue technologische Lösungen und Wissensaustausch hilft das Projekt beim Erhalt der Technologieführerschaft Europas und schafft eine Basis für langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Die Umsetzung des Projekts ist nicht nur eine wegweisende Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Dänemark, sondern auch zwischen den beteiligten Übertragungsnetzbetreibern 50Hertz (Deutschland) und Energinet (Dänemark).
Deutschland und Dänemark haben sich darauf geeinigt, die Kosten für die erforderliche Unterstützung für die Offshore-Windenergie zu teilen. Die Kostenteilung spiegelt die Stromflüsse des Windparks nach Deutschland und Dänemark sowie den beiderseitigen Nutzen des Projekts wider. Das Projekt ist das erste Beispiel für die gemeinsame Finanzierung einer Offshore-Windfarm durch zwei Länder und stellt einen Meilenstein in der Entwicklung der europäischen Offshore-Zusammenarbeit dar.
Bornholm Energy Island ist eine von acht zentralen „Energieautobahnen“, die von der Europäischen Kommission als vorrangig eingestuft wurden, und wird die weltweit erste HVDC-Hybridverbindung mit mehreren Terminals sein. Bornholm Energy Island erhält eine Unterstützung von 645 Millionen Euro durch die Connecting Europa Facility der Europäischen Union.
Politik
Nordsee-Gipfel: VKU fordert Kursanpassung beim Offshore-Ausbau
Hamburg, Berlin, 26.01.2026.
– Anlässlich des Nordsee-Gipfels fordert der Verband kommunaler Unternehmen (VKU) einen Realitätscheck beim Ausbau der Windenergie auf See. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing: „Ziel muss ein Offshore Ausbau sein, der bezahlbaren Strom liefert und Investitionen verantwortbar macht.“ Dafür brauche es klare Leitplanken: Netzausbau durch Überbauung minimieren, Verschattung vermeiden und dadurch Netzauslastung maximieren, sowie Ausschreibungen reformieren.
Liebing verweist auf die Größenordnung der geplanten Investitionen: „In Offshore-Wind sollen inklusive Netzausbau mehrere einhundert Milliarden Euro investiert werden. Damit dieses Geschäftsmodell tragfähig ist, müssen Offshore-Parks deutlich mehr Volllaststunden liefern als moderne Anlagen an Land. Heute ist das oft nicht der Fall“, so Liebing und weiter: „Leider beobachten wir aktuell heftige Kostensteigerungen beim Übertragungsnetzausbau ebenso wie bei Offshore-Anlagen. Dies betrifft nicht nur Deutschland, sondern ist in ganz Europa und sogar weltweit zu beobachten, weshalb viele Projekte aktuell scheitern. Für den Offshore-Ausbau ist der Übertragungsnetzausbau sowohl auf See wie auch an Land jedoch zwingende Voraussetzung. Wir müssen daher aufpassen, nicht zu Systemkosten zu kommen, die sich ansonsten für 20 Jahre auf 200 Euro und mehr die Megawattstunde aufsummieren können. Das wäre für niemanden tragbar.“
Der VKU fordert deshalb eine ehrliche Bestandsaufnahme und eine klare Prioritätensetzung: Netzausbau nur dort, wo er unvermeidbar ist und maximale Auslastung der vorhandenen Infrastruktur. Ausschreibungen müssten mehr Wettbewerb ermöglichen und verschiedene, auch kleinere, Akteure zum Zug kommen lassen, um das Klumpenrisiko bei scheiternden Projekten zu reduzieren. Gleichzeitig müsse der Ausbaupfad in der Deutschen Ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) system- und kosteneffizient gestaltet werden.
Die Linie des VKU lautet: Entzerren statt verdichten. Eine stärkere Koordinierung mit den Nachbarländern und gemeinsame Offshore-Projekte könnten Erträge verbessern und Netzkapazitäten sinnvoller nutzen. „Die gegenseitige Verschattung frisst Erträge und damit Wirtschaftlichkeit. Sie ist kein Randproblem, sie ist zentral. Deshalb ist eine engere Abstimmung mit unseren Nachbarn richtig und wichtig. Wenn wir realistisch planen wollen, müssen wir dichter stehende Parks entzerren. Wir empfehlen 45 bis 50 GW Erzeugungsleistung als Zielgröße für die deutsche ausschließliche Wirtschaftszone. Das ist aus unserer Sicht vernünftig und verantwortbar“, erklärt Liebing.
Der VKU begrüßt, dass das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie (BSH) sowie die Bundesregierung Schritte in diese Richtung unternommen haben. Die vorgeschriebene Überbauung der Netzanschlusspunkte und die höhere Netzauslastung wertet der VKU als richtige Weichenstellungen. Liebing: „BSH und Bundesregierung sind zuletzt mit guten Ansätzen vorangegangen. Die höhere Netzauslastung zeigt: Es geht auch klug, nicht nur groß.“
Auch an Land besteht Handlungsdruck: Der Offshore-Strom erreicht die Verbraucher vor Ort erst durch Umspannung auf die 110kV-Verteilnetze und tiefer, die vielerorts in kurzer Zeit erheblich verstärkt werden müssen. Dafür braucht es schnellere und praxistaugliche Genehmigungen, insbesondere für die Ertüchtigung bestehender Trassen. Es gehe nicht um überall neue Leitungen, sondern um eine schnelle Modernisierung der Netze, die bereits vorhanden sind.
Der VKU plädiert für eine Offshore-Strategie, die ökonomische Vernunft, technische Realität und europäische Abstimmung verbindet. Liebing: „Wir müssen die Energiewende so gestalten, dass sie nicht nur schneller, sondern vor allem bezahlbar und belastbar ist.“
Politik
DAK warnt vor Finanzlücke in 2027

Berlin 26.01.2026
– In der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) droht 2027 eine Finanzlücke von bis 12 Mrd Euro. DAK Chef forderte in Berlin 3 Stufen-Planfür stabile Kassenbeiträge ;
– Neue IGES Projektion berechnet weitere Beitragsentwicklung in der Sozialversicherung.
– 2035 könnte die Gesamtbelastung der Sozialabgaben erstmals die 50% Marke erreichen.
– DAK-Gesundheit plädiert für Gesundheitsreformen.
Foto: © PWO
-

 Politik7 Tagen ago
Politik7 Tagen agoDeutsch-Romänische Gespräch
-
Politik6 Tagen ago
Deutsch-ukrainische Gespräch
-

 Berlin6 Tagen ago
Berlin6 Tagen agoKinder: Opfer der Gier
-
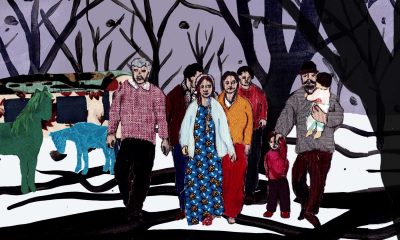
 Kunst23 Stunden ago
Kunst23 Stunden agoAICA Deutschland zeichnet Kunstmuseum Wolfsburg aus
-
Politik6 Tagen ago
Cyber- und Sicherheitspakt: Deutschland und Israel proben den Ernstfall
-
Wirtschaft6 Tagen ago
ifo Institut: Familienunternehmen in Europa erwarten ein besseres Wirtschaftsjahr 2026
-
Politik6 Tagen ago
Exportkontrolle von Rüstungs- und Dual use-Gütern
-
Wirtschaft1 Tag ago
ifo Institut: Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie setzt Abwärtstrend fort
-

 Berlin23 Stunden ago
Berlin23 Stunden agoWenn Gesundheit zur Reise-Motivation wird
-
Politik1 Tag ago
Pressestimmen zum Iran und der US-Regierung
-
Politik1 Tag ago
Bundeskanzler Merz reist in die Golfstaaten
-
Politik6 Tagen ago
Arbeitsmarkt weiter unter Druck
-
Europa1 Tag ago
Abgeordnetenversammlung für europäische Verteidigungsunion
-
Politik1 Tag ago
Angriffe gegen Kunst durch die Mullahs Regime
-
Politik19 Stunden ago
Deutschland gewinnt internationalen KI-Preis